Fast nichts funktioniert ohne Strom: Doch wie sind wir auf einen Black Out vorbereitet? Arnold Schuhmacher beschäftigt sich mit dem Thema intensiv, denn er ist im Landratsamt Leiter des Katastrophenschutzes.
Das Thema Black Out, also der Komplettausfall der Stromversorgung, gehört zu seinem Tagesgeschäft und das nicht erst seit dem Ukraine-Krieg. Zusammen mit Kreisbrandmeister Florian Vetter sorgt er dafür, dass der Landkreis alle nur erdenklichen Katastrophen-Szenarien durchspielt und die passenden Pläne zur Schadensbewältigung in der Schublade hat.

Die beiden sind Teil einer ganzen Verantwortungskette. Nach oben folgen die Regierungspräsidien, die Länder und der Bund, nach die Städte und Gemeinden. Das bedeutet, dass dem Katastrophenschutzstab im Landratsamt in erster Linie eine Kommunikations- und Steuerungsaufgabe zukommt.
Und genau diese Aufgaben werden von Schuhmacher und seinem Team regelmäßig geübt. „Perfekt organisierte Kommunikation ist hier das wichtigste, jeder muss wissen, wer für was zuständig ist und welche Ressourcen wo und wie abrufbar sind“, bringt es der Katastrophenschützer auf den Punkt.
Rückfall auf alte Technik
Damit das funktionieren kann, ist das Landratsamt mit einem Notstromaggregat ausgestattet, das zumindest den eigenen Betrieb unterstützt. Um sicher zu stellen, dass sie auch mit der Außenwelt noch kommunizieren können, wenn das normale Telefonnetz, Handymasten und der Digitalfunk der Hilfsorganisationen und der Polizei ausgefallen ist, setzen sie parallel noch auf altbewährte Techniken.

So sind an strategisch wichtigen Stellen auch weiterhin noch alte, analoge Funkgeräte im Einsatz, die dort auch mit Batterie betrieben werden können. Und beim Telefon gibt es zu wichtigen Kontaktpunkten wie dem Klinikum oder den Rathäusern noch eine extra geschaltete und geschützte Standleitung für analoge Telefone. Wenn alle Stricke reißen, werden Melder per Fahrzeug losgeschickt.
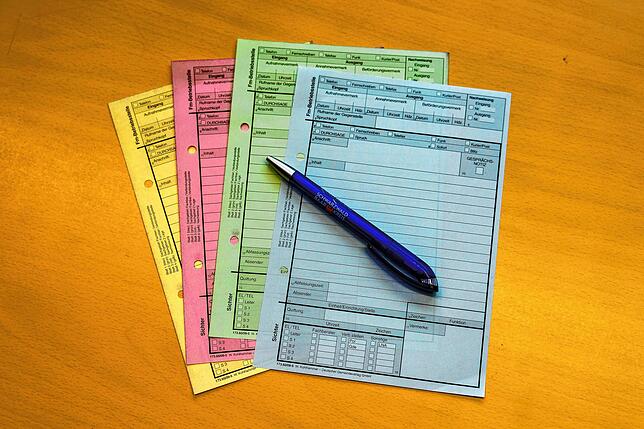
Kompetenzen werden gebündelt
Die Abläufe und Verantwortlichkeiten im Krisenstab sind genau geregelt und werden regelmäßig geübt. Polizei, Technisches Hilfswerk (THW), Feuerwehr, Bundeswehr und andere Stellen sind darin vertreten. So werden Kompetenzen und Entscheidungsbefugnisse an einem Ort gebündelt. Der Krisenstab informiert die Bevölkerung über die Nina Warn-App oder zukünftig auch per SMS im Handynetz (Cell-Broadcast).

Auch zum Thema Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und Lebensmitteln macht man sich beim Katastrophenschutz Gedanken. Die Notfallpläne dazu wurden bereits mehrfach in Übungen durchgespielt. Regelmäßig gibt es einen Runden Tisch mit Vertretern der Energieversorger.
Gute Kontakte in die Schweiz
Der Schwarzwald-Baar-Kreis tauscht sich zudem regelmäßig mit den Nachbar-Kantonen in der Schweiz aus. „Es ist einfach unerlässlich, dass jeder jeden persönlich kennt und im Ernstfall direkt erreichen kann“, sagt Arnold Schuhmacher. Nur sei garantiert, dass keine Falschinformationen aus ungesicherten Quellen das Geschehen beeinflussen.
So bereiten sich Städte und Gemeinden vor
Die Rathäuser haben den Bevölkerungsschutz vor Ort im Auge. Brigachtals Bürgermeister Michael Schmitt zum Beispiel analysiert mit seinem Team regelmäßig alle Katastrophen-Szenarien. In mehreren Workshops werden sie dabei auch vom Katastrophenschutz und den Energieversorgern unterstützt.

Alle Notfallpläne werden immer und immer wieder überprüft und angepasst. Das geht bis hin zu einem Laufsystem, um Mitarbeiter und andere Kontakte finden und aktivieren zu können, selbst wenn kein Telefon oder Funk mehr funktionieren.
Eigener Notstrom ist das nächste Ziel
Den Luxus eines eigenen Notstromaggregats für das Rathaus hat Brigachtal allerdings noch nicht, so wie sicherlich die meisten Gemeinden im Land. Aber auch das ändert sich, die Beschaffung geeigneter Gerätschaften ist in die Wege geleitet. Ziel ist es, dass zumindest eine der Hallen der Gemeinde im Notfall betrieben und beheizt werden kann.
Und was passiert eigentlich im Schwarzwald-Baar-Klinikum, wenn das Stromnetz zusammenbricht?






