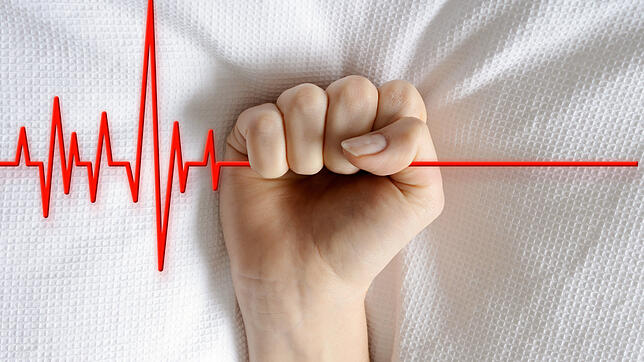In welcher Form ist ein Sterben in Würde durch die Palliativmedizin gut möglich – und wo sehen Sie die Grenzen?

Achim Gowin: Ein würdiges Sterben unter „dem Mantel“ der Palliativmedizin ist möglich, wenn diese Form der begleitenden Medizin stationär und ambulant flächendeckend installiert ist. Jedes Pflegeheim, jede Klinik braucht eine Palliativeinheit, jede größere Stadt ein stationäres Hospiz. Darüberhinaus sollten überall ambulante Palliativdienste (SAPV) eingerichtet sein. So können Menschen mit schweren finalen Krankheitsbildern begleitet werden. Auch diese Menschen möchten von ihrem Leiden, nicht aber von ihrem Leben erlöst werden. Die Grenzen dieser Begleitung sind gegeben, wenn Patienten trotz Wahrnehmung aller Therapieangebote auf ihrem Todeswunsch beharren. Ist zuvor eine schwere depressive Verstimmung ausgeschlossen worden, so gibt es für diese die Möglichkeit zur Entlastung. Diese beinhaltet auch die Einleitung einer terminalen Sedierung, das heißt, bei schlimmsten Schmerzen oder Luftnot mit starken Medikamenten einen schlafähnlichen Zustand herzustellen, der die Möglichkeit beinhaltet, dass der Tod früher eintritt. Diese indirekte Sterbehilfe wird palliativmedizinisch bereits angewandt.
Paul Bischof: Die Palliativmedizin kann nicht alle Probleme lösen, da nicht alle Symptome therapierbar sind, etwa bei Unverträglichkeiten von Medikamenten. Es gibt Menschen, die einen anderen Weg gehen wollen. Auch das haben wir zu akzeptieren. Ich bin manchmal froh, dass ich nicht in Deutschland zuhause bin. Ich habe meine 15 Gramm Pentobarbitural zuhause. Assistierter Suizid ist keine "Volksseuche", die Suizidrate geht insgesamt zurück. Palliativmedizin und, in wenigen Fällen, der assistierte Suizid schließen sich nicht aus, sondern sind zwei Alternativen. In vier bis fünf Fällen habe ich persönlich Sterbehilfe geleistet, Patienten begleitet, die nicht mit der Organisation "Exit" gehen wollten. Eine Patientin bat mich, sie zu begleiten, sie war zuvor zu 80 Prozent der Zeit im Spital. Sie war auch schon auf der Palliativstation gewesen. Die Begleitung der Patientin in den Tod war eindrücklich – und wenn ich wieder zur Überzeugung käme, dass es mit meinem Gewissen vereinbar ist, würde ich erneut auf einen solchen Wunsch eingehen.
Was verstehen Sie genau unter einem assistierten Suizid?
Achim Gowin: Der assistierte Suizid ist die Selbsttötung nach vorheriger Organisation eines todbringenden Mittels in der Regel durch einen Arzt. Das Mittel muss vom Sterbewilligen selbstständig eingenommen werden, in der Schweiz etwa darf der Arzt bei diesem Vorgang zugegen sein, darf aber nicht die Hand des Patienten führen. Viele Schwerstkranke können diese Selbsttötung gar nicht mehr durchführen. In Deutschland muss der Arzt sogar formal den Raum verlassen. Eine groteske und menschenunwürdige Situation. Ich denke, wir haben an unserem Lebensende Besseres verdient. Der ärztlich assistierte Suizid wird von meiner Seite nicht dogmatisch abgelehnt, aber in seiner gegenwärtig praktizierten Form kommt er nicht in Betracht. Auch hier ist zu betonen, dass, so sich die Rechtslage irgendwann ändert, der assistierte Suizid nie kommerziell gewerblich, sondern immer nur in zertifizierten Palliativzentren eingesetzt werden darf, dort, wo ein palliativmedizinisches Team zuvor die Entscheidungslage des Patienten bestätigen konnte.
Paul Bischof: Wichtig ist: Suizid beinhaltet im Wortlaut: jemand bringt sich selbst um. Ich assistiere ihm dabei. Wenn ich für Dignitas ein Zeugnis ausstelle, dass der Patient über die nötige Urteilsfähigkeit verfügt, habe ich auch einen Beitrag geleistet. Oder: Ich stelle das tödliche Mittel zur Verfügung und gebe dem Patienten etwas gegen das Erbrechen.
Welche Gefahren birgt der assistierte Suizid – oder die Öffnung dieser Möglichkeit?
Achim Gowin: Es ist zu befürchten, dass bei der Freigabe des ärztlich assistierten Suizids die Sicherheitsvorkehrungen zunehmend ineffektiv werden und die Indikation schrittweise ausgeweitet wird. Das Inkaufnehmen des assistierten Suizids im Bereich des therapeutischen Spektrums schädigt das Verhältnis zwischen Arzt und Patient und höhlt das Vertrauen der Patienten und der Gesellschaft in den ärztlichen Beruf aus. Im ungünstigsten Falle ist gerade bei aufwändig schwerstkranken Patienten, unter anderem auch bei dementen Patienten, eine großzügige und dann möglicherweise entgleitende Indikationsstellung für den ärztlich assistierten Suizid zu befürchten. Es sollte weiterhin so sein, dass Ärzte die Pflicht haben, Schmerz und Leid zu beseitigen, nicht aber die Person, die an Schmerzen leidet.
Welche Form des assistierten Suizids ist in Deutschland erlaubt, wo ist die Grauzone und in welchen Bereichen suchen sich Patienten, die dies wünschen, Hilfe in der Schweiz oder den Niederlanden?

Rudolf Rengier: Ausgangspunkt ist das verfassungsrechtlich geschützte Recht auf Selbstbestimmung, das auch das Sterben umfasst. Vor diesem Hintergrund ist die Selbsttötung in Deutschland schon sehr lange nicht mehr strafbar, und da es einen derartigen Straftatbestand nicht gibt, ist grundsätzlich auch die Unterstützung des Suizidwilligen durch eine andere Person (egal ob Angehöriger, Arzt, Pfleger) nicht strafbar. Mit dem assistierten Suizid ist genau das gemeint, nämlich, dass der Sterbewillige sich beim Sterben von einem Dritten helfen lässt. Wichtig für die Straflosigkeit des Dritten ist freilich: Erstens muss der Sterbewillige die Entscheidung für seinen Tod eigenverantwortlich getroffen haben. Zweitens muss er den entscheidenden letzten Schritt zu seinem Tod selbst vollziehen. In der Sprache des Strafrechts: Der eigenverantwortlich handelnde Suizident muss die Tatherrschaft über den unmittelbar lebensbeendenden Akt haben. Typisch ist das Trinken eines sicher tödlich wirkenden Getränks durch den Sterbewilligen, das andere etwa besorgt und zubereitet haben. Das Bereitstellen von technischen Vorrichtungen durch den Helfer, die die Vornahme des lebensbeendenden Aktes durch den Suizidenten erleichtern, ändern an der Straflosigkeit nichts.
Ein Fallbeispiel
Eine Patientin, M., entschloss sich nach der Diagnostizierung einer Alzheimer-Demenz und langen Planungen, durch Selbsttötung aus dem Leben zu scheiden. An dem ausgewählten Tag kamen ihre eingeweihten Kinder; gemeinsam aß man noch einmal und trank ein Glas Sekt. Nachdem M. eine tödliche Dosis Tabletten eingenommen hatte, wurde sie müde und legte sich in ihr Bett. Die Kinder verabschiedeten sich von M. Sie schlief schnell fest ein und starb nach einigen Stunden. Die Kinder hätten M.s Leben nach ihrem Einschlafen noch retten können. In diesem Fall sind alle Helfer grundsätzlich straffrei, wie Rengier schreibt, dieser Fall der Staatsanwaltschaft München sei aber auch so vorstellbar, dass die tödlich Dosis, die M. trinkt, nicht sie zusammengestellt hat, sondern der Ehemann, ein Freund, der Hausarzt, ein eigenes Kind. In dieser Form mit Würde zu sterben, ist ein Anliegen des assistierten Suizids, erläutert Rudolf Rengier. (Fall der Staatsanwaltschaft München I; Verfügung vom 30. Juli 2010 – 125 Js 11736/09)