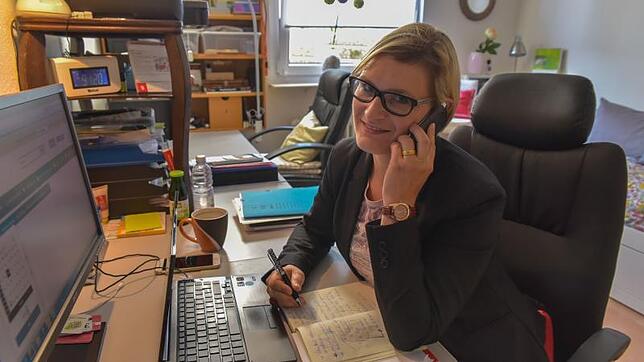St. Georgen – Von Unternehmen und Arbeitnehmern wird heutzutage mehr denn je Flexibilität gefordert. Kurzfristiges Reagieren auf Kundenanfragen oder Aufträge wird heute ebenso selbstverständlich erwartet wie ständige Erreichbarkeit. Gleichzeitig steht die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hoch im Kurs bei Unternehmen und Beschäftigten. Deshalb gewinnt das Modell „Arbeiten von zuhause“ immer mehr an Bedeutung. Es hilft, Anforderungen der Kunden mit Ansprüchen von Unternehmen und Mitarbeitern zu vereinbaren. Internetanschluss vorausgesetzt, macht es die Technik heute möglich, sich von nahezu jedem Ort mit seinem Unternehmen zu verbinden.
Alexandra Zink-Colacicco arbeitet seit sechseinhalb Jahren bei der Firma ebm-papst in St. Georgen als Referentin in der Personalentwicklung. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Weiterbildung von Mitarbeitern für die Standorte St. Georgen, Herbolzheim und Lauf. „In der Regel haben unangelernte Kräfte viel Potenzial. Dafür habe ich ein eigenes Seminarprogramm entwickelt, um diese Mitarbeiter bis zum Facharbeiter zu bringen“, erklärt Alexandra Zink-Colacicco ihre Aufgabe. Dazu gehört auch, dass die Mitarbeiter, die an einer Weiterbildung interessiert sind, in Kooperation mit der Berufsschule Sulgen während der Arbeitszeit Berufsschulunterricht haben.
Um die Weiterbildungspläne für die Mitarbeiter auszuarbeiten, ist es nicht zwingend notwendig, dass Alexandra Zink-Colacicco täglich in der Firma ist. Seit der Geburt ihres ersten Kindes vor dreieinhalb Jahren nutzt sie deshalb die Möglichkeit des Homeoffice. An drei Tagen in der Woche arbeitet Alexandra Zink-Colacicco von zuhause aus. An zwei Tagen ist sie vor Ort, um Mitarbeitergespräche zu führen. Die Ausstattung ihres Heimarbeitsplatzes, Laptop mit separatem Monitor und Firmenmobiltelefon, hat der Arbeitgeber zur Verfügung gestellt. Über das firmeninterne Intranet ist sie mit der Firma verbunden und hat so jederzeit Zugriff auf alle für sie relevanten Daten.
Allerdings erfordert die Arbeit von zuhause aus auch ein hohes Maß an Disziplin. Wie im Büro muss die tägliche Arbeitszeit eingehalten werden. Deshalb gehen ihre beiden dreieinhalb und ein Jahr alten Kinder auch an den Tagen, an denen Alexandra Zink-Colacicco von zuhause aus arbeitet, in die Kinderkrippe. Dennoch erleichtert die Möglichkeit, von zuhause aus arbeiten zu können, der zweifachen jungen Mutter aus Schramberg-Sulgen den Tagesablauf enorm. Nicht nur, weil sie sich täglich rund eine Stunde Fahrtzeit und nervige Parkplatzsuche in St. Georgen spart. „Ich bin flexibler, wenn mal eines der Kinder krank ist. Das spart auch dem Arbeitnehmer Kosten, weil ich dann keinen extra Urlaubstag dafür nehmen muss“, erklärt sie.
Nicht nur für Arbeitnehmer hat Teilzeitbeschäftigung einen Vorteil. Auch Unternehmen profitieren von attraktiven Arbeitszeitmodellen für ihre Mitarbeiter. Wolfgang Beyer ist Personalleiter bei ebm-papst. Wie er sagt, hat nach dem Bundesteilzeit- und Befristungsgesetz grundsätzlich jeder Arbeitnehmer zunächst das Recht, bei seinem Arbeitgeber nach Teilzeitarbeitsmodellen zu fragen: „Der Arbeitgeber muss sich dann damit befassen.“ Allerdings kann der Arbeitgeber das Gesuch auch ablehnen, wenn beispielsweise für eine Fachkraft in einem speziellen Bereich, die 50 Prozent arbeiten möchte, nachweislich kein weiterer Mitarbeiter gefunden werden kann, der die entstehende Lücke auffüllt.
„Wir haben 133 Mitarbeiter, die Teilzeitmodelle nutzen. Die meisten, 122 davon, sind Frauen. Darunter acht Mitarbeiter, die Homeoffice nutzen.“ Wie Beyer sagt, wird auf die Wünsche der Mitarbeiter eingegangen, „wenn es von der betrieblichen Seite her machbar ist.“ Bei der Gewinnung neuer Fachkräfte spielt Teilzeitarbeit beziehungsweise arbeiten von zuhause aus allerdings keine Rolle. „Wir werben nicht aktiv damit. Wir sind dann bereit, wenn die Fachkräfte da sind und sich hier Schwierigkeiten etwa bei der Kinderbetreuung ergeben.“
Nicht nur im Bürobereich bietet ebm-papst Teilzeitarbeitsmodelle an. Ein nicht geringer Teil der Teilzeitbeschäftigten kommt aus dem Produktionsbereich. „Diese Modelle bewegen sich, bei einer Wochenarbeitszeit von 35 Stunden, von sieben Wochenstunden bei Werkstudenten über 15, 18, 20 oder 25 bis hin zu 30 Stunden.“ Da hier der Großteil im Schichtbetrieb tätig ist, müsse dies genau auf die Schichtarbeit abgestimmt werden. „Aber wir versuchen immer, die Wünsche unserer Mitarbeiter zu berücksichtigen.“
Mit der Teilzeitbeschäftigung sieht Wolfgang Beyer im Übrigen keinerlei Leistungsnachteile für das Unternehmen verbunden. Und der Vorteil für das Unternehmen liegt klar auf der Hand. „Für uns als Unternehmen hat das den Vorteil, dass wir qualifizierte Mitarbeiter nicht verlieren und trotzdem auf deren Kapazität zurück greifen können.“
Ralf Wurster, Geschäftsführer der Südwestmetall-Bezirksgruppe Schwarzwald-Hegau, ist der Ansicht, dass Telearbeit für größere Unternehmen interessant ist, da hier die Personalentwicklung ausgeprägter ist. Als Vorteil sieht er klar die Flexibilität für die Mitarbeiter, die etwa bei langer Fahrt zur Arbeit eine große Zeitersparnis haben. Ob ein Unternehmen die Möglichkeit bietet, von zuhause zu arbeiten, sei auch Vertrauenssache. „Telearbeit lebt von gegenseitigem Vertrauen und ist letztlich ergebnisabhängig.“ Als Kritikpunkt merkt er an, dass der soziale Aspekt leiden könnte, etwa wenn der persönliche Austausch zwischen den Mitarbeitern fehlt.
Die Anforderungen ändern sich
Der Wandel zur Industrie 4.0 ist nicht nur eine technische Herausforderung. Die Vernetzung und Digitalisierung hat auch Konsequenzen für die Arbeitswelt
- Der Automatisierungsgrad steigt: Die Automatisierung der Produktion erreicht eine neue Qualität. Digitalisierung und Vernetzung verketten bislang getrennte Wertschöpfungsprozesse zu einem übergreifenden System, das vom Rohstofflieferanten bis zum Endverbraucher reicht. Die Arbeit in einer „Smart Factory“ ist flexibler und weniger planbar. Gleichzeitig steigt der Druck auf die Beschäftigten. Sie tragen mehr Verantwortung, haben aber weniger zu entscheiden, weil viele Handlungsparameter vom vernetzten System vorgegeben werden.
- Soft Skills werden wichtiger: Neben hoher Qualifikation, IT-Kenntnissen, Lernbereitschaft und Flexibilität benötigen Fachkräfte in der Arbeitswelt 4.0 mehr und stärker ausgeprägte soziale Kompetenzen (Soft Skills) wie Stressresistenz und Teamfähigkeit.
- Arbeit neu organisieren: Auf die Arbeitsorganisation kommen veränderte Anforderungen zu. Die Smart Factory kennt keine festen Produktionszeiten und –mengen mehr, sie passt die Laufzeiten der Maschinen an den Bedarf des Netzwerks an. Das schlägt sich auch im Personalbedarf nieder. Die Belegschaftsstärke schwankt innerhalb eines Arbeitstages, der Personaleinsatz muss möglichst flexibel organisiert werden. Bereitschaftsarbeit verdrängt Schichtarbeit und langfristig planbare Arbeitszeiten.
Dies setzt innovative Arbeitszeit- und Vergütungsmodelle voraus, die etwa alternierende Projekt- und Freizeitphasen beinhalten. Um die geforderte Flexibilität zu erreichen, müssen Unternehmen noch mehr für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf tun.
- Vernetzung darf nicht überfordern: Neben den Arbeitszeiten ändern sich auch die Arbeitsbedingungen. Die vernetzte Produktion führt zu einer höheren psychischen Belastung. Wegen der engen Verzahnung der Wertschöpfungsketten können bereits kleine Fehler zu großem Schaden führen. Zudem bleibt im voll vernetzten und digitalisierten System keine Abweichung von der Norm unbemerkt. Es lastet Druck auf den Beschäftigten, den die Unternehmen abfedern müssen, etwa durch die Etablierung einer Fehlerkultur, wie die gezielte Vorbereitung auf Stresssituationen, das Einüben von Verhaltensweisen bei Störfällen oder die Einführung des Vier-Augen-Prinzips bei wichtigen Entscheidungen. Auch die flexibilisierten Arbeitszeiten sorgen für mehr Stress. Gefragt sind Modelle, in denen sich Arbeits- mit Ruhephasen abwechseln. (tom)