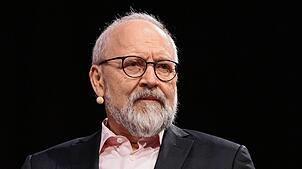Für den Urlaub ist Hubert Knoblauch zuständig. Das passt. Aktiv, sportlich, immer unterwegs, gerne mit dem Motorrad. Auf dem Bildschirm seines Laptops ist ein Kartenausschnitt von Venedig zu sehen. „Sollte man noch gesehen haben, wer weiß wie lange es die Insel noch gibt, bevor sie der Kollaps erreicht“, sagt der hagere Mann mit dem langsam grauer werdenden, doch nach wie vor dichten Haar.
Erst war nur der Finger etwas taub
Hubert Knoblauchs eigene Reisen beschränken sich heute auf kurze Momente an der Seestraße. Motorrad fährt er nur noch mit – im Beiwagen. Den Laptop bedient er mit Blicken und Worten. Hubert Knoblauch sitzt im Rollstuhl. Er wird sterben. Ziemlich sicher viel früher als gesunde Menschen. Er leidet an Amyotropher Lateralsklerose (ALS), einer unheilbaren Krankheit des motorischen Nervensystems, die vor einigen Jahren wegen der sogenannten Ice-Bucket-Challenge stärkere Beachtung fand.
Menschen weltweit forderten sich im Internet gegenseitig dazu auf, sich mit einem Eimer eiskalten Wassers zu überschütten und für die ALS-Forschung zu spenden. Mit hundertfacher prominenter Unterstützung weltweit, darunter Oscar-Preisträger Tom Hanks, Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, aus Deutschland waren Schlagersängerin Helene Fischer oder Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann dabei.
Knoblauch selbst ereilte die Diagnose vor rund zehn Jahren. Zum Arzt ging er wegen eines Taubheitsgefühls, zunächst nur im Finger. Die Prognose war schlecht, Spezialisten versprachen ihm eher Monate als Jahre weitere Lebenszeit. Ein Schock. Miterleben zu müssen, wie bald darauf die Lähmungen unaufhaltsam fortschreiten und selbstständiges Handeln zunehmend schwindet, war nur schwer zu ertragen.
Zehn Jahre später akzeptiere er, dass es so ist, wie es ist; versuche sich bestmöglich anzupassen und das zu tun, was noch möglich ist. So gleichmütig war er nicht von heute auf morgen. „Stellen Sie sich vor, wie mich das anfangs schon genervt hat, in der Kneipe das Bier aus dem Strohhalm trinken zu müssen“, erinnert er sich. Bis hin zum größten Einschnitt sollte es da noch dauern: sich nicht mehr bewegen zu können. „Diese Unbeweglichkeit, dieses Gefangensein, diese Abhängigkeit von anderen Menschen. Das ist eigentlich das, was am meisten nervt“, fasst er zusammen. Genervt? Ja. Klagend und frustriert? Nein. Humorvoll und stark? Trotzdem. Wie behält er sich das bei?
Der Todkranke schenkt seinen Begleitern den Blick aufs Wesentliche

„Ich denke nicht an den Tod oder das Sterben, das verdränge ich“, erklärt Hubert Knoblauch, „ich war noch nie ein Grübler“. Nicht im Alltag, nicht während der Zeit mit Jens Freiter. Der Softwareentwickler, ein großgewachsener Mann Mitte 40, hat einst erfolgreich ein Unternehmen gegründet. Er ist einer von etwa 160 Menschen, die sich ehrenamtlich für den Hospizverein Konstanz engagieren. Freiter trifft Schwerstkranke oder Sterbende, er ist Angehöriger auf Zeit. Die wöchentlichen Treffen mit Hubert Knoblauch, sagt auch er, werden von anderen Themen als Krankheit oder Tod geprägt: Politik, Urlaub, Sport. „Und wenn mir die Kinder zuhause mal wieder auf der Nase herumtanzen“, ergänzt Freiter und lacht.
Hubert Knoblauch schenkt viel, Gelassenheit und den Blick aufs Wesentliche vor allem. Über Kleinigkeiten rege er sich nicht mehr auf, schätze das kleine Glück dafür umso mehr. Ärger mit der Krankenkasse, die wieder einmal Behandlungskosten nicht erstatten will: sei’s drum. Dass ihm jemand während eines Spaziergangs zulächelt: toll. „Mir bringt es mehr als ihm, hier zu sein“, stellt Freiter deshalb klar. Sein Blick verrät, dass er seinem Gegenüber mit diesem Satz nicht schmeicheln möchte. Er meint das genau so. „Für meine Frau“, kontert Knoblauch, „ist Herr Freiter auch eine große Entlastung, die Freiräume bringen mehr Abwechslung in ihr Leben“. Herr Freiter. Und Herr Knoblauch. Sie sind noch beim Sie, ein Zeichen des Respekts, man lerne sich ja noch kennen, sagen sie.
Einen Wunsch hat Hubert Knoblauch trotz aller Unerschütterlichkeit: „Wenigstens wieder stehen oder gar gehen können wäre schon schön.“ Jens Freiter tut sein Möglichstes. Er setzt sich einfach hin, wenn die beiden sich unterhalten, schafft Augenhöhe. Eine Kleinigkeit für ihn, ein Zeichen des Respekts.
In Momenten des Übergangs da sein
Vertraut, aber nicht befreundet. Nah, aber mit respektvollem Abstand. Was auf Jens Freiter und Hubert Knoblauch zutrifft, gilt für die ehrenamtliche Tätigkeit im Konstanzer Hospiz generell. Zumal, wenn es um Momente des Übergangs geht. Als solche bezeichnet Daniele Seifert die Zeit, die sie mit schwerstkranken oder sterbenden Menschen verbringt.

2012 hat sie darin eine Aufgabe gefunden und seither viele lange und weniger kurze Begleitungen miterlebt. „Ich kann nicht alle paar Monate einen Freund verlieren“, erklärt sie. „In erster Linie geht es ohnehin um ihn, nicht um mich.“
Er, das ist Martin Baier-Waldmann. Seit etwas mehr als einem Jahr kennen sich die beiden und müssen jetzt aufgrund der Veränderung in der Erkrankung „eine neue Kommunikationsform finden“, beschreibt Daniele Seifert. Die bisherigen wöchentlichen Treffen – Gespräche auf einer Parkbank am Seerhein, vor allem – sind nicht mehr möglich. Martin Baier-Waldmann, Vater und Ehemann, verlässt die Kraft, die Sprache hat er verloren. Eine sehr schwere Krankheit setzt ihm unverkennbar zu. Auch wenn er beim Vorbeigehen in der Palliativ-Station des Konstanzer Klinikums freundlich lächelt und den Arm zum Gruß hebt.
Eine Freundin braucht er mit Daniele Seifert nicht, sein Leben ist auch so reich erfüllt. „Es geht nicht um die Linderung von Einsamkeit. Martin hat einen eigenen Freundes- und Bekanntenkreis. Meine Funktion ist eine andere, nämlich die einer Begleitung auf Zeit außerhalb seiner privaten Beziehungen“, fasst Seifert zusammen. Unabhängig von den Gesprächsinhalten sagt sie über die Art und Weise, wie sie geführt werden: „Der Blick richtet sich auf das Leben, nicht auf den letzten Augenblick.“ Wenn sie spüre, dass es zu Ende geht, verabschiede sie sich innerlich von der Begleitung auf Zeit.
Angefangen hat es mit einem Fußball
Mimjo Baier-Waldmann spielt im Sturm – und er gewinnt meistens. Warum das hier steht? Weil Mimjo will, dass es hier steht. Der junge Mann stellt Bedingungen und es ist schwer, sie ihm abzuschlagen. Also: Mimjo, Stürmer, das Herz schlägt für Brasilien, für den Superstar Neymar. Natürlich spielt er selbst auch im Verein. Ihn als aufgeweckt zu beschreiben, wäre nicht nur untertrieben, es wäre glatt gelogen. Mimjo spricht schnell und viel. Nur eines will er nicht hören und schon gar nicht beantworten: Fragen nach seinem kranken Papa.
Familie Baier-Waldmann ist etwas Besonderes. Grundsätzlich. Und für das Konstanzer Hospiz im Besonderen. Alle Familienmitglieder werden begleitet, das ist eine Seltenheit. Vater Martin Baier-Waldmann von Daniele Seifert, mit Mimjo trifft sich seit zwei Jahren Henning Brockmann. Der Radolfzeller ist selbst vierfacher Vater, nach einer privaten Krise vor einigen Jahren habe er „etwas Sinnvolles anfangen wollen“, sagt er. Seither engagiert er sich für die Kinder- und Jugendhospizarbeit im Landkreis Konstanz. So wie insgesamt etwa zwei Dutzend weitere Personen in der Region.
Heute rinnt Brockmann der Schweiß von der Stirn. Es ist heiß auf dem Fußballplatz am Europa-Haus, die Sonne knallt herab, ein Gewitter kündigt sich aus der Ferne an. Natürlich der Fußballplatz, es gäbe keinen besseren Platz, um Mimjo Baier-Waldmann und Henning Brockmann zu treffen. Mit Fußball hat alles angefangen.

„Weißt du noch, als wir uns richtig kennenlernten, haben wir vor der Garage im Laub auch gekickt“, erinnert Brockmann seinen jüngeren Mitspieler während einer Pause. Sicher weiß der das noch. „Und ich habe dich abgezogen“, erinnert Mimjo seinen Mitspieler, „so wie meistens eben“. Weil man das feixende Duo eigentlich doch wegen eines ernsten Themas trifft, geistert die Frage durch den Kopf: Warum kann dieser Junge so selbstbewusst, fröhlich und ausgelassen sein? Sollte seine eigene Welt nicht so verhangen sein, wie der Himmel durch die herannahenden Gewitterwolken?
Zum einen: Nein. „Es geht nicht darum, hier ständig Probleme zu wälzen. Unsere Treffen sind Alltag, nicht mehr und nicht weniger, nur möglichst ungekünstelt“, erklärt Brockmann. Zum anderen: Mimjos Stimmung ist manchmal sehr wohl verhangen. „So ausgelassen wie heute ist er nicht immer“, beschreibt der drahtige Mann. Und als der Junge gerade den Ball in einem Gebüsch sucht, ergänzt er noch: „Natürlich würde er gerne mit seinem Papa kicken.“
Ein Papa, der Henning Brockmann nicht sein kann – und auch nicht sein will, sagt der Radolfzeller. Kein Wort dazu von Mimjo, stattdessen die Aufforderung an den Autor dieses Textes: „Komm jetzt, Elfmeterschießen!“ Der Autor verliert, aber es ist knapp.
Hinter der Geschichte
Was passiert eigentlich in der Talgartenstraße, im Haus am Park? Werden dort jeden Tag Konstanzer während ihrer letzten Stunden betreut oder dämmern unter Medikamenten aus dem Bewusstsein? Diese Fragen hat sich auch der Autor jahrelang gestellt. Als der Hospizverein gegründet wurde, ging er noch zur Schule und eilte oft dort vorbei – vom Schulbus bis nach Hause in Richtung Paradies oder andersherum. Spätestens jetzt ist er eines Besseren belehrt und weiß: Im Haus am Park wird vor allem gelebt.