Kind oder Karriere – die Ärztin strich das „oder“ schnell durch ein „und“. „Man hat im Leben viele Rollen und es macht keinen Sinn, sich nur um die Kinder und sich selbst zu drehen“, sagt sie. Zehn Tage vor der Geburt des ersten Sohnes 2004 absolvierte die Neurologin ihre Facharztprüfung in Psychiatrie: „Das musste ich jetzt noch schnell durchziehen.“
Dabei lagen Käppelers Neigungen zunächst eher woanders. „Irgendwas mit Sprachen“ wollte sie eigentlich machen. Die 51-Jährige stammt in vierter Generation aus einer Medizinerfamilie. Mit zehn Jahren kam Käppeler aus Polen nach Bad Mergentheim, verbrachte ihre Jugend in Tübingen. Nach einem kurzen Intermezzo in Design und Textiltechnik wechselte sie dann doch an die Uni Tübingen, um Medizin zu studieren: „Mir war der Arztberuf irgendwie vertraut. Ich hatte die Stimme meines Großvaters im Ohr: Egal, was ist, Patienten wird es immer geben.“
Promotion, Assistenz, Facharztausbildung – der Weg ist lang
Die junge Medizinstudentin begeisterte sich für die Neurologie, vor allem kognitive Prozesse, wie das Gedächtnis oder Lernen – insbesondere von Sprachen – interessierte sie. Während eines Praktikums in den USA arbeitete sie in einer neuropsychologischen Spezialabteilung, wo Menschen mit Aphasien, also zentralen Sprachstörungen, behandelt wurden. „So fand ich Sprache in der Medizin wieder“, erklärt Käppeler. Es folgten 1995 die Promotion, eine Assistenzarztstelle und die Ausbildung zur Neurologin. 2000 zog sie an den Bodensee und begann ihre Psychiatrieausbildung im Zentrum für Psychiatrie Reichenau.
Kurz nach der Geburt arbeitete sie wieder
In ihrer Zeit am Bodensee lernte die Leitende Ärztin ihren Ex-Mann, den Vater ihrer beiden Söhne, kennen. Auch beruflich veränderte sie sich und wechselte in die Schmieder Kliniken. Bereits kurz nach der Geburt des ersten Sohnes 2004 unterrichtete sie angehende Ergotherapeuten in Neurologie. Das Baby war im Maxicosi dabei. Dazu arbeitete sie tagesweise in einer Praxis aus und erstellte Gutachten. „In der Beziehung zum Vater meiner Kinder war es gar nicht möglich, nicht mehr zu arbeiten“, erklärt sie, „er war damals Freiberufler, hatte bereits zwei heranwachsende Kinder, wir hatten ein kleines Haus und irgendwoher musste das Geld ja kommen.“
„Es gab einige Grenzsituationen“, sagt sie heute
2006 kehrte sie in die Schmieder Kliniken zurück, wenig später wurde der zweite Sohn geboren. Nach neun Monaten Elternzeit arbeitete die Oberärztin wieder, stockte auf und war schließlich in Vollzeit tätig. Mit der Kinderbetreuung wechselte sich das Paar häufig ab. „Es gab einige Grenzsituationen, als die Kinder klein waren“, erinnert sich die Leitende Ärztin. Immer wieder klingelte mitten in der Visite das Telefon. „Der Kindergarten rief an: Läuse“, sagt Käppeler.
Heute kann sie über die Momente, in denen das Vereinbarkeits-Chaos ausbrach, lachen. Damals sei es oft zu viel gewesen. „Ich hatte oft das Gefühl, viel zu wenig Zeit mit meinen Kindern zu haben, eine Rabenmutter zu sein“, erinnert sie sich. Die Ehe zerbrach. „Beide arbeiten 70 Prozent – das wäre mein bevorzugtes Modell gewesen“, sagt sie.
Männliche Chefärzte
Führungsjobs in der Medizin sind männlich geprägt, so auch am Medizin Campus Bodensee. Dort arbeiten 30 Chefärzte und Leitende Ärzte, darunter sind zwei Frauen und es gibt 78 Oberärzte, davon sind 20 weiblich.
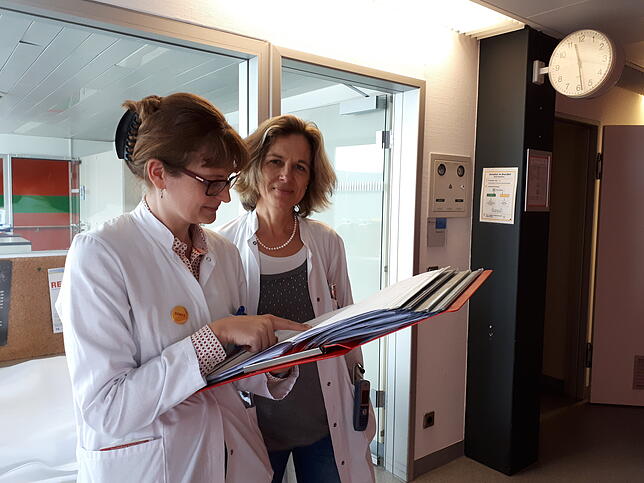
Dank ihrer guten Ausbildung rutschte Käppeler nach der Scheidung nicht in die Armuts-Statistik. Sie wechselte nach Friedrichshafen, sich dort zur Geriaterin, also Altersmedizinerin, weiterzubilden und die Leitung der Geriatrischen Rehabilition zu übernehmen. Die Medizinerin zog mit den beiden Söhnen, damals im Grundschulalter, nach Immenstaad. Seither wuppt sie Familienleben größtenteils alleine. Freunde und die Mutter sind eine „emotionale und tatsächliche Stütze“, so Käppeler.
Mehr Alleinerziehende
Von 1996 bis 2015 ist die Zahl der Alleinerziehenden von 1,3 Millionen auf 1,6 Millionen gestiegen. 18 Prozent aller Kinder leben bei einem Elternteil. Neun von zehn Alleinerziehenden sind Frauen.
„Das Thema Kitaplätze ist ein Dauerbrenner“, sagt sie, „aber was oft vergessen wird, ist die qualifizierte Hausaufgabenbetreuung für Schüler.“ Denn wenn Kinder in die Schule kommen, seien sie längst nicht selbstständig. „In meiner Generation fühlt man sich als Mutter manchmal immer noch schlecht, wenn man nicht das dampfende Mittagessen serviert und den Kindern anschließend bei den Aufgaben hilft“, meint sie.
Hohes Armutsrisiko
Laut Statistischem Bundesamt sind Alleinerziehende dreimal so häufig von Armut bedroht sind als andere Familien mit Kindern. Rund zwei Drittel der Alleinerziehenden haben keine 1000 Euro gespart.
Hausaufgabenbetreuung gebe es nur in der Grundschule und auch da sei sie nicht verbindlich. „Das hat mit Bildungsgerechtigkeit nicht viel zu tun, was wir hier in Süddeutschland vorleben“, betont Käppeler, „die Auslese findet im Grundschulalter statt, Ganztagsangebote an weiterführenden Schulen stecken noch in den Kinderschuhen.“ Gerade Alleinerziehende seien angewiesen auf qualitative Betreuung.
Wenig Teilzeit-Chefs
Insgesamt gibt es Medizin Campus Bodensee nach eigenen Angaben 122 Führungskräfte (Medizin, Pflege, Verwaltung), darunter 77 männliche und 45 weibliche; 25 der 122 arbeiten in Teilzeit – zehn Frauen und 15 Männer.
Monika Käppeler hat ihren Weg gefunden. Sie arbeitet 75 Prozent plus Hintergrunddienste in der Neurologie. Die Wochenendbereitschaft findet statt, wenn die Söhne beim Vater sind. Der Tag der Leitenden Ärztin beginnt früh und endet spät. Morgens kocht sie das Essen für die beiden Jungs vor, die mittags nachhause kommen. „Da stehen dann zwei Teller mit Wattzahl und Minutenangabe für die Mikrowelle“, sagt Käppeler lachend. „Erziehung braucht einfach Zeit und Frustrationstoleranz und wenn man einigermaßen konsequent und liebevoll sein will, sowieso“, sagt sie.
Und da sind die Besprechungen am Spätnachmittag
Elterliche Präsenz am Nachmittag sei ihr wichtig. Doch das klappt nicht immer. „In Leitungsfunktionen ist es selbstverständlich, Besprechungen am späten Nachmittag zu machen“, bemerkt sie, „aber zu jeder männlichen 120-Prozent-Arbeitskraft gehört eben die Frau, die die Wäsche in den Schrank legt.“
Homeoffice und flexible Arbeitszeiten? Nicht im Umgang mit Patienten
Die Medizin sei immer noch ein konservativer Bereich, die sich im Spagat zwischen Berufung und Generation Y schwer tue. Homeoffice und flexible Arbeitszeiten seien bei Tätigkeiten mit Menschen nicht machbar. „Muttertiere“, wie sich Käppeler nennt, in Leitungsfunktion – und dann noch in Teilzeit – sind eine echte Ausnahme. Dabei liege der Gewinn für den Arbeitgeber auf der Hand: „Man arbeitet ganz anders, wenn man Kinder hat, flexibler, praktischer, verwurzelter.“ Und man werde realistischer: Was schafft man – und was eben nicht?
Monika Käppeler, sie ist eine Chefin mit Teamgeist und Empathie, die viel schafft – und zwar trotz oder wegen weiblich, alleinerziehend und Migrationshintergrund.
Die Serie
Wir.Frauen ist eine Reihe von Portraits über Frauen, die mitten im Leben stehen. In unserer redaktionellen Arbeit begegnen uns sehr häufig männliche Gesprächspartner. Männer besetzen den Großteil der Führungspositionen in Unternehmen, beim Staat, in unserer Stadt. Sie bilden die Mehrheit in den politischen Gremien. Und sie treten somit auch häufiger in die Öffentlichkeit. Wir zeigen Frauen, die sich vor allem im Hintergrund halten. Frauen, die tagtäglich Großartiges leisten – als Managerinnen, als Selbstständige, als Mütter, als Pflegerinnen – und nicht selten sind sie sogar alles auf einmal.
Wir zeigen alle Facetten des Frau-Seins – und zwar abseits der üblichen Rollen-Stereotype. Denn zur Identität eines Menschens gehört natürlich weit mehr als nur das Geschlecht. Und trotzdem gibt es, das haben die Debatten über Feminismus und #metoo sehr deutlich gezeigt, ein großes Bedürfnis in der Gesellschaft nach starken, weiblichen Stimmen. Wir lassen diese Frauen sprechen. Kennen Sie auch eine Frau aus Friedrichshafen oder Umgebung, die wir portraitieren sollten?
Schreiben Sie uns: friedrichshafen.redaktion@suedkurier.de! (sab)









