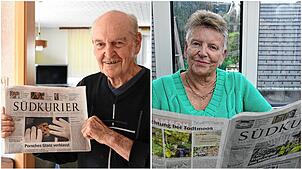Politische Entscheidungen zu großen gesellschaftlichen Themen sind immer auch werthaltige Entscheidungen. Die sittlich-moralische Dimension politischer Entscheidungsalternativen aufzuzeigen, aber auch die sittlich-moralischen Konsequenzen getroffener Entscheidungen oder des Ausbleibens solcher Entscheidungen aufzuzeigen: das ist eine wichtige Aufgabe des Ethikrates. Hinzu kommt, dass dieser die politischen und anderen gesellschaftlichen Institutionen auf Entwicklungen in unserer Gesellschaft und Kultur hinweist, die politisches Handeln erfordern.
Die Themen setzt der Ethikrat selbst. Doch welche großen Themen kommen auf die Gesellschaft in den nächsten vier Jahren drängend zu, auf dass sie im Ethikrat eine große Rolle spielen?
Zu nennen sind vor allem Themen, denen eine nachhaltige Bedeutung beizumessen ist. Welche Auswirkungen haben Sammlung, Verarbeitung und Analyse großer Mengen von Gesundheitsdaten, zudem die zunehmende Digitalisierung und mobile Vernetzung des Alltags auf unser Verständnis von Selbstbestimmung, Gesundheit, Zusammenleben? Welche Einflüsse haben selbststeuernde Systeme (Beispiel: Roboter und selbstfahrende Autos, aber auch Drohnen) auf Selbstbestimmung, Intimität, Sicherheit der Person? Wie werden sich assistierende technische Systeme – man denke zum Beispiel an Pflegeroboter – auf die Erhaltung von Selbstständigkeit im Falle von Hilfe- und Pflegebedürftigkeit,
auch im Falle von Demenz auswirken? Wie stellen wir uns zu den neuen Erkenntnissen auf dem Gebiet der Fortpflanzungsmedizin und den sich daraus ergebenden, biomedizinischen und ethische Fragen der Präimplantations- und Gendiagnostik sowie der Embryospende und -adoption? Inwieweit muss die Fortpflanzungsmedizin in unserem Land stärker reguliert werden? Schließlich geht es um die Frage der Selbstgestaltung und Selbstoptimierung des Menschen durch neue Erkenntnisse und Interventionsmöglichkeiten in der Hirn-, der Mensch-Maschine- und der digitalen Forschung. Stößt das Streben nach zunehmender Selbstgestaltung und Selbstoptimierung nicht an eine natürliche Grenze? Verstoßen wir mit diesem Streben gegen unsere Anthropologie? Geraten die Grenzen unserer Existenz nicht aus dem Blick?
Fragen der Generationengerechtigkeit und sozialen Gerechtigkeit, das besondere Schutzbedürfnis des Menschen in gesundheitlichen Grenzsituationen, die Fortentwicklung der Palliativversorgung, der demografische Wandel als politischer Handlungsauftrag, grundlegende Fragen der allgemeinen wie auch der individuellen, spezifischen Menschenwürde aus philosophischer, theologischer, psychologischer und medizinischer Sicht.
Ein selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter führen zu können und die Ressourcen alter Menschen der Gesellschaft besser nutzbar zu machen, sind zwei Ihrer Kernanliegen. Inwiefern kann der Ethikrat hier der Politik Impulse geben?
Differenzierte Aussagen mit Blick auf die seelischen, geistigen und sozialen Ressourcen alter Menschen wie auch mit Blick auf die zunehmende körperliche, zum Teil auch geistige und emotionale Verletzlichkeit müssen in den politischen Diskurs eingebracht werden, damit wir auf die verschiedenen Ausdrucksformen des Alters entsprechend differenziert antworten: Inwieweit sollten wir – bei ausdrücklicher Beachtung der großen sozialen und ökonomischen Unterschiede im Alter – die Ressourcen des Alters in der Arbeitswelt und in der Bürgergesellschaft stärker nutzen? Wie können wir alte Menschen im Falle stark ausgeprägter körperlicher, geistiger, emotionaler Verletzlichkeit besser unterstützen und schützen – durch eine Weiterentwicklung von Medizin, Pflege, Seelsorge, sozialer und psychologischer Arbeit? Wie können wir die finanziellen Ressourcen der Kommunen erhöhen, damit diese wieder in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben der Daseinsvorsorge zu bewältigen und zudem soziale Gerechtigkeit zu verwirklichen?
Der Ethikrat ist ein hochkarätig besetztes Gremium, und eine Ehre für jeden, der berufen wird. Worauf freuen Sie sich in persönlicher und besonderer Weise?
Auf intensive, für die Politik hochrelevante, auch Konflikte in inhaltlichen Dingen nicht scheuende, immer lösungsorientierte Diskussionen. Zudem auf die Möglichkeit intensiver Auseinandersetzungen mit politischen Entscheidungsträgern, in die wir Ergebnisse der Forschung sowie grundlegende ethische Überlegungen einbringen können. Ich freue mich auch darüber, etwas für unser Land und unser Gemeinwohl tun zu können – was mir ein besonders wichtiges Motiv ist.
Ich war 14 Jahre lang Vorsitzender der Altenberichtskommission der Bundesregierung sowie Mitglied internationaler und nationaler Fachkommissionen. Da der demografische Wandel – hier vor allem die gesellschaftliche Gestaltung des Alters und der Generationenbeziehungen – immer größeres Gewicht gewinnt, wuchs im Deutschen Bundestag das Interesse, der Alters- und Generationenforschung wie auch der Palliativversorgung noch größere Bedeutung im Ethikrat zuzuordnen.
Mit welchem persönlichen Aufwand ist diese neue Aufgabe für Sie verbunden und wie wird er vergütet?
Es handelt sich um ein Ehrenamt. Es werden keine Honorare gezahlt. Ich gehe davon aus, dass monatlich neben dem Sitzungstag zwei Arbeitstage investiert werden müssen. Als Mitglied des Vorstands des Ethikrates rechne ich noch einen weiteren Arbeitstag hinzu. Man hat also ganz schön zu tun. Aber man kann eben auch etwas bewirken – und, ich wiederhole mich: etwas für unser Land, für unser Gemeinwohl tun. Diesem etwas von dem zurückgeben, was es für einen selbst getan hat.
Die anderen Fragen berühren meine Person als Glied des Ethikrates. Auf diese Frage antworte ich als Privatperson: Man sollte keine generellen Fahrverbote ab einem bestimmten Lebensalter aussprechen, weil damit die großen Unterschiede in der physischen, der sensorischen und der geistigen Leistungsfähigkeit im Alter vernachlässigt würden. Entscheidend ist die Prävention: Ich schlage schon seit mehreren Jahren vor, dass man ab einem bestimmten Lebensalter – zum Beispiel 70 Jahre – eine Testfahrt mit einem geschulten Beobachter einführt, die alle fünf Jahre wiederholt wird. Dies ist notwendig, weil es sich bei Einbußen im Seh- und Hörvermögen um natürliche Alternsverluste handelt. An dieser Erkenntnis darf man nicht einfach vorbeigehen. Ich würde übrigens noch weiter gehen: Jeder Fahrer, jede Fahrerin sollte in bestimmten Zeitabständen eine solche Testfahrt absolvieren: Unterhalb eines Alters von 70 Jahren sollte diese freiwillig, bei einem Alter ab 70 Jahren hingegen obligatorisch sein.
Zur Person
Der Psychologe und Gerontologe Andreas Kruse wurde 1955 geboren, er ist seit April Mitglied im Deutschen Ethikrat. Der Universitäts-Professor ist Direktor am Institut für Gerontologie der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Er ist Mitglied der Altenberichtskommission der Bundesregierung sowie der Familienberichtskommission. Von 2000 bis 2002 war er Mitglied der Expertenkommission des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, Kofi Annan, zur Erstellung des „International Plan of Action on Ageing“ (Weltaltenplan). Kruse wohnt in Überlingen, er ist verheiratet mit Sylvia Kruse-Baiker, SPD-Stadträtin, er hat zwei Kinder und zwei Enkelkinder. (shiI)