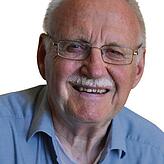Zumindest die Alten unter uns, die mit „Europa“ als einer neuen Welt jenseits von Krieg und Nationalismus einmal aufgewachsen sind, haben zunächst vielleicht lieber nach innen geblickt – auf die vertraute westdeutsche, deutsch-französische, westeuropäische Zuversicht und gefühlte Sicherheit. Inzwischen hat die Ungewissheit über den Zusammenhalt der EU und ihre künftige Stellung in der Welt uns aber erreicht. Es ist die Stunde der Konfrontation mit den europäischen Realitäten.
Aber es ist auch der Augenblick der Selbstvergewisserung – des Nachdenkens darüber, wer wir sind. Für beide Dimensionen einer Besinnung möglichst ohne Angst und Ausflucht können wir auf wertvolle Handreichungen zurückgreifen, darunter zwei kürzlich erschienene Bücher, die hier vorgestellt werden sollen – oder vielmehr gegeneinander gestellt. Das eine – „Europadämmerung. Ein Essay“ stammt von dem bulgarischen Denker Ivan Krastev. Im Vorwort schreibt er: „Das ist der Graben zwischen denen, die den Zusammenbruch des Kommunismus und den Zerfall des einstmals mächtigen Blocks am eigenen Leib erfahren, und jenen, die von solchen traumatischen Ereignissen verschont blieben. Osteuropäer interpretieren den Stand der Dinge aus einem Gefühl der Angst oder sogar des Schreckens heraus, während Westeuropäer weiterhin glauben, alles werde schon gut werden.“
Jede Nation für sich?
Das andere Buch – „Der europäische Traum. Vier Lehren aus der Geschichte“ – verdanken wir Aleida Assmann, Literaturwissenschaftlerin an der Universität Konstanz und Trägerin des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2018. Sie schreibt gegen eine offiziell ritualisierte, formelhaft verflachte „Vergangenheitsbewältigung“ an. Europa verfügt danach über ein unerschöpftes, aber vernachlässigtes, gewissermaßen brachliegendes Erbe an verbindenden friedenspolitischen, rechtsstaatlichen, demokratischen Errungenschaften. Grundlegend ist darüber hinaus die ernste Aufarbeitung dessen, was man im Zweiten Weltkrieg getan hat – nicht nur was man erlitten hat. Europa muss dieser transnationalen Ressourcen nur wieder inne werden. Eine wirkliche Chance hat der inzwischen reichlich selbstvergessene Staatenbund für Aleida Assmann nur, wenn er sich seiner Entstehungsgeschichte im Zeitalter zweier Weltkriege erinnert – und in der Ära der Entkolonisierung anderer Kontinente. Jede Nation für sich, aber nicht in sich selbst verstrickt, nicht separat, nicht isoliert Nation für Nation, sondern in Respekt und Aufgeschlossenheit für das Selbstverständnis der Anderen.

Beide Autoren haben das Jahr 2015 und die Flüchtlingspolitik Angela Merkels präsent. Aleida Assmann widmet ihr Buch „den Trägern und Stützen der Willkommenskultur“. Für Ivan Krastev ist es hingegen gerade die „Flüchtlingskrise“, die das Nachkriegseuropa definitiv überfordert. Und es in seinen Grundfesten bereits zu untergraben, zu zersetzen begonnen hat. Von heute her gesehen, wirkt diese Diagnose nicht mehr ganz taufrisch. Und sie geht provozierend, ja bestürzend weit: “In rechtlicher wie praktischer Hinsicht ist es durchaus sinnvoll, eine klare Unterscheidung zwischen Flüchtlingen und Migranten zu treffen. Schließlich ist es nicht dasselbe. Migranten verlassen ihre Heimat in der Hoffnung auf ein besseres Leben, während Flüchtlinge aus ihrer Heimat fliehen, um ihr Leben zu retten.“ Provozierend auch deshalb, weil Krastev eine rote Linie überschreitet und sich an die Seite des Rechtsradikalismus zu stellen scheint, was Aleida Assmann ihm dann auch entgegenhält: „Zum Beispiel hat er die Schockerfahrung der Massenmigration von 2015 wiederholt als ‚Europas 11. September‘ bezeichnet. Diese Beschreibung ist nicht unproblematisch, ... weil Krastev Flüchtlinge, die auf Gefahren und existenzielle Not reagieren, mit Terroristen gleichsetzt.“
Warum kam es zum Brexit?
Wer sich dazu versteht, Krastev dennoch weiterzulesen, wird freilich schnell merken, dass es sich lohnt. Statt auf den Willen zur Diffamierung der EU um jeden Preis trifft er hier auf den Willen zu einer Auseinandersetzung ohne Tabus – von den Niederlanden bis Polen, von Großbritannien bis Ungarn. Zur Brexit-Abstimmung etwa: „Bis Anfang unseres Jahrhunderts war der Anteil der Arbeiter an den wahlberechtigten Beschäftigen auf ein Fünftel geschrumpft, während ein Drittel der Wähler über einen Hochschulabschluss verfügte. Plötzlich interessierte sich niemand mehr wirklich für die Arbeiter. Zugleich ließ die dramatische Zunahme der in der Mehrzahl liberal gesinnten Hochschulabsolventen eine kulturelle Kluft zwischen ihnen und den Resten der Arbeiterklasse entstehen. Die Migration war die Frage, in der die beiden Großbritanniens aneinandergerieten.“
Europa stirbt im Osten
Aber Aleida Assmann trägt die Kontroverse auf das ureigene Terrain des Diskussionsgegners – in den osteuropäischen Erfahrungshintergrund, aus dem dieser kommt und von dem aus er den Zustand der EU zu interpretieren sucht. Danach stirbt die EU, wenn sie denn stirbt, von Osten nach Westen. Ivan Krastev hat zusammen mit dem amerikanischen Rechtswissenschaftler Stephen Holmes sozusagen noch eins draufgelegt und jüngst auch noch einen „Nachahmungsimperativ“ ins Spiel gebracht, der die Gesellschaften Osteuropas in ihrem nationalen Stolz verletze, sie demütige und sie Europa in der Tiefe ihrer Identität abspenstig mache und entfremde. Die Zäsur von 1989 mit ihren großen, stürmischen Hoffnungen auf Freiheit und Wohlstand in einem endlich wieder zusammengefügten Europa sei Geschichte. Die begeisterte Westorientierung von damals habe inzwischen antieuropäischen Haltungen und Ressentiments Platz gemacht – bis hin zur Feindseligkeit. „Ein Leben als Imitator ruft unweigerlich Gefühle wie Unzulänglichkeit, Minderwertigkeit, Abhängigkeit, Identifikationsverlust und unwillkürliche Unaufrichtigkeit hervor.“
Nachvollziehbar – nur, wie gelangt man von dieser Seelenlage und Misere zu Regimes, wie dem in Ungarn oder in Polen? Die ja nicht nur die EU spalten, sondern jeweils auch die eigene nationale Gesellschaft. Zwar – leider – nicht mit ihrer Flüchtlingspolitik, aber doch mit ihrer Zerstörung des Rechtsstaats und mit ihrer antidemokratischen Medienpolitik.
Aleida Assmann erinnert hier in einem bemerkenswerten Einspruch auch an die ostmitteleuropäischen Dissidenten und Befreiungsbewegungen vor 1989: „Der Kampf um die Menschenrechte vor 1989 ist aber gerade deshalb ein so wichtiges Kapitel in der Geschichte der EU, weil die Ostblockstaaten eben nicht, wie es die Geschichte der Sieger will, mit dem westlichen Gut der Demokratie ‚beschenkt‘ beziehungsweise kolonial überrannt und überwältigt worden wären, sondern weil sie dieses Gut selbst erkämpft und damit ihr eigene Utopie in die Europäische Union eingebracht haben.“
Aleida Assmann: „Der europäische Traum. Vier Lehren aus der Geschichte“. Verlag C.H. Beck, 4. Auflage 2019. 208 Seiten. 16,95 Euro.
Ivan Krastev: „Europadämmerung. Ein Essay.“ Edition Suhrkamp, 4. Auflage 2018. 243 Seiten. 14 Euro.