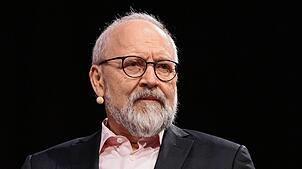Man lebt nur zweimal gilt für James Bond aber nicht für uns. Als Geheimagent führt er ein Doppelleben. Ein Original und eine Fälschung. Wer dagegen kein erdachter Spion ist, hat nur ein Leben.
Nichts zeigt das deutlicher als Caspar David Friedrichs Gemälde „Der Mönch am Meer“: Von einer Düne aus blickt er in die Ferne. Am Horizont droht eine endlose Nacht, in der sich Konturen, Kanten und Formen auflösen.

Die Landschaft ist zur Fläche reduziert. Vor der einsamen Figur liegt das Meer als dunkler Abgrund. Schattenhaft schlägt es Wellen. Es schwankt in derselben Weise, wie der Wind die Dünen geformt hat, auf denen der Mönch steht. Unscheinbar und klein gehen die dunklen Falten seiner Kutte in der Düsternis des Wassers auf.
Wäre da nicht die Andeutung von Haut und Haaren, er wäre schon eins mit dem Meer.
Die Weite der Einsamkeit
Dieser beinahe Mord in der Farbe wird bald darauf ein ganz realer Tod. Die Wirkung der Bilder Friedrichs ist schon zu seinen Lebzeiten enorm: Für den Dichter Heinrich von Kleist zeigt dieser Mönch am Meer eine Seelenlandschaft.
Er sieht darin nicht weniger als die Wesensbestimmung des Menschen: „Nichts kann trauriger und unbehaglicher sein, als diese Stellung in der Welt“, schreibt er. Als hätte man ihm die Augenlider abgeschnitten, beschreibt Kleist die Wahrnehmung dieser bildgewordenen Endlosigkeit.
Doch dem Poeten wird die Weite zur Leere. Folgt man dem Buchautor Florian Illies, so versteht Kleist Friedrichs Gemälde als Aufforderung, ja als Bühnenbild für seine ganz eigene Konsequenz aus dem Gesehenen.
Auf einer Düne am Wannsee setzt sich Kleist eine Pistole auf die Brust und drückt ab. Selbstmord als Folge einer Bildbetrachtung. Die Einsicht, dass der Mensch den zufälligen Widersprüchen der Natur erliegt, hat Kleist aus dem Leben gerissen.
Nichts an Caspar David Friedrich entspricht dem Zeitgeist – und doch trifft er gerade heute einen Nerv. Walt Disneys Bambi spaziert durch die nebelverhangenen Felsformationen des Elbsandsteingebirges und der berühmte „Wanderer über dem Nebelmeer“ blickt digital aufbereitet mal in die Welt von Videospielen, mal auf zerstörte Städte.
Friedrichs Bilder wurden hundertfach variiert und zu Kunstdrucken und Kopfkissenbezügen verarbeitet. Trotzdem behaupten sich seine Einzelstücke gegen die Legion zurechtgezupfter Kopien. Aber warum zieht uns seine Malerei auch noch 250 Jahre später in den Bann?
Der Natur hingeben
Wie der Mönch wirken die Menschen in den Landschaften Friedrichs oft klein, teilweise mickrig. Mit dem Rücken stehen sie zum Betrachter und lenken den Blick auf die eigentliche Hauptrolle: die Natur.
Versunken blicken die Personen aufs Meer, zum Mond, auf den Nebel. Doch der zurückhaltende Eigenbrötler aus Greifswald bildet nicht nur Landschaften ab. Er prägt den Szenen das menschliche Innenleben ein. „Ich muss mich dem hingeben, was mich umgibt, mich vereinigen mit meinen Wolken und Felsen, um das zu sein, was ich bin“, schreibt der Maler.
Damit verwirklicht er, was der Schriftsteller Novalis zum Programm der Romantik erhoben hat: „Die Welt romantisieren heißt, sie als Kontinuum wahrzunehmen, in dem alles mit allem zusammenhängt“.
Und so atmet in den Wellen, Schiffen, Ruinen, Wurzeln und Ästen in Friedrichs Pinselstrichen nicht nur das Erleben, sondern das Leben selbst.

Das Geheimnis der Natur ist bedrohlich
Er inszeniert eine übermächtige Natur, weil er weiß, unter dem in der Sonne funkelnden Wasser lauert der Tod. Die schönste Oberfläche birgt tödliche Gefahren. Friedrich muss das bereits in seiner Kindheit erfahren. Auf Schlittschuhen bricht er durchs Eis.
Als ihn sein kleiner Bruder rettet, stürzt dieser selbst unter die gefrorene Decke und ertrinkt. Auch seine Mutter stirbt früh. Das Leben ist keine Gewissheit. Diese frühen Todeserfahrungen grundieren die tiefe Melancholie seiner Bilder. Doch der setzt dem entgegen: „Aus dem Tod wird Leben geboren.“
Über diese Gleichzeitigkeit von strahlender Schönheit und Bedrohung sprechen die Künstler der Romantik als Erhabenheit. Um die ungefilterte Natur dem Menschen greifbar zu machen, bedürfe es der Kunst zur Vermittlung, sagt Friedrich.
Dieser natürliche Widerspruch ist das ideale Motiv, um gegen Verwissenschaftlichung und Rationalisierung vorzugehen. Das Wundern droht in Formeln und Gesetzen unterzugehen.
Die enträtselte Welt
Die damals begonnene Entwicklung ist heute zur Digitalisierung aller Lebensbereiche mutiert. Die Technik macht die Welt zunehmend verfügbar. Dokumentationen zerren jede Tätigkeit, jedes Tier und jede Pflanze vor die Kamera. Mit dem Flugzeug können wir die entlegensten Orte erreichen, jeder Fleck wird kartografiert und vermessen.
Geld lässt uns noch so kuriose Wünsche verwirklichen. Doch die wachsende Kenntnis über alles, bedeutet vor allem die Entzauberung der Welt, diagnostiziert der Soziologe Max Weber schon vor über 100 Jahren.
Friedrichs Naturbilder, angereichert mit seinen Empfindungen, sind näher an der Natur als es die abertausenden Fotografien, die sich auf den Google-Servern stapeln, je sein könnten.
Sie sind nur Abbilder von etwas, dass der Betrachter nicht erlebt hat. Gezeichnet in Pixeln kultiviert sich so der Eindruck: „Wenn ich wollte, könnte ich das auch“.
Die vielen Simulationen entfremden uns zunehmend von der Welt als Original. Die Kopien können nur darstellen, was es schon gibt. Es ist, wie Caspar David Friedrich sagt, nur die Kunst vermittelt zwischen Mensch und Natur, weil sie die Empfindungen dieses Verhältnisses enthält.
Die Natur kehrt zurück
Indem der Mönch beinahe in der Farbe verendet, zeigt er, dass Mensch und Natur aus derselben Materie bestehen. Sie sind aneinander gekettet. Nur so wird der eigene Lebensraum dem Menschen zur lebensgefährlichen Bedrohung.
Das anzuerkennen offenbart eine Demut vor der Welt, die in der digitalen Hochgeschwindigkeitsumgebung zugrunde geht.
Die Welt zerbricht am Klimawandel
Als im April 1815 in Indonesien der Tambora ausbricht, vergilben Schwefelschleier die Atmosphäre. Das gelbgefärbte Licht erzeugt prächtige Sonnenaufgänge und ebenso prächtige Untergänge. Friedrich ist überwältigt von diesem Anblick.
Doch wieder birgt die Schönheit die Gefahr: die intensiven Farben bringen den Hunger. Von jetzt auf gleich wandelt sich das Klima. 1816 folgt als Jahr ohne Sommer. Es kommt zu Unwettern und Überschwemmungen, der Winter wird extrem kalt. Der Naturmaler erlebt das Konzentrat eines massiven Klimawandels – ohne es zu wissen.
Heute sind uns die Gefahren eines Klimawandels bewusster denn je. Das ewiggeglaubte Eis der Pole schmilzt und Klimaberechnungen sagen enorme Temperaturanstiege voraus. Doch welche Folgen dieser Wandel auf unsere Lebensumstände hat, kann kaum in Smartphone-Schnappschüssen festgehalten werden. Diese Eindrücke kann nur die Kunst vermitteln.
Denn nur ein Mensch trägt das Bewusstsein in sich, dass das, was um ihn passiert, etwas mit ihm zu tun hat. Deshalb werden auch die Kreativitätsergüsse künstlicher Intelligenzen niemals kunstfähig.
Weil ihnen die Grundlage der eigenen Erfahrung fehlt, können sie nie mehr als ein Abbild sein. Die virtuellen Wiedergänger der Natur können nur die Oberfläche simulieren, nicht aber ihre Tiefe nachempfinden.
Caspar David Friedrichs Bilder zeigen uns die Natur als Gefäß des Menschen. Es ist verletzbar, kann aber auch selbst verletzen. Mit der Erkenntnis, die Welt verlieren zu können, kehrt auch ihre Bedrohlichkeit zurück.
Die Widersprüchlichkeit unseres Lebensraums anzuerkennen, bedeutet die Zauber des Unbestimmten zu wirken, die von Friedrichs Bildern ausgehen. Denn sie erinnern daran, die Natur als Lebensraum gibt es nur einmal – als Original.