Zu kompliziert, Probleme mit der Software, überlastete Finanzamt-Mitarbeiter: die Abgabe der Grundsteuererklärung lief alles andere als rund, die Abgabefrist wurde um drei Monate verlängert. Am 31. Januar läuft sie nun endgültig aus. Was passiert, wenn man den Termin verschwitzt und wie es mit den neu berechneten Werten für die Grundsteuer nun weitergeht: wichtige Fragen und Antworten.
Was passiert, wenn die Grundsteuerklärung nicht bis zum 31. Januar vorliegt?
Dann verschicken die Finanzämter erst einmal eine Erinnerung. „Das ist allerdings keine Fristverlängerung“, stellt Jasmin Bühler, Sprecherin im Finanzministerium Baden-Württemberg, klar. Spätestens nach der Erinnerung sollten versäumte Erklärungen deshalb unverzüglich nachgeholt werden. Andernfalls könnte es zu Verspätungszuschlägen und einer Schätzung des Grundsteuerwertes durch das Finanzamt kommen, warnt Bühler.
Ich habe die Grundsteuerklärung fristgerecht abgegeben. Was passiert jetzt?
Sobald das Finanzamt die Erklärung bearbeitet hat, bekommt man einen so genannten Grundsteuerwert- sowie einen Grundsteuermessbescheid zugesandt. Bis zum 31.12.2022 hatten die Finanzämter in Baden-Württemberg rund 500.000 solcher Bescheide erstellt, so das Finanzministerium Baden-Württemberg auf Anfrage.
Was steht auf diesen Bescheiden drauf?
Vier Blätter graues Papier, zusammengetackert zu den zwei Bescheiden: so sieht die Antwort vom Finanzamt aus. Auf dem Grundsteuerwertbescheid stehen die Daten des Grundstücks (Adresse, Flurstücknummer, Fläche, Bodenrichtwert) sowie die Namen der Eigentümer. Außerdem wird mittels Grundstückgröße sowie Bodenrichtwert der so genannte Grundsteuerwert berechnet – also der Wert des Grundstücks für die Grundsteuer. Das Finanzministerium Baden-Württemberg weist darauf hin, dass dieser Wert mitnichten der Wert ist, den man als Grundsteuer zu zahlen hat.
Und was ist mit dem zweiten Bescheid?
Im Grundsteuermessbescheid taucht gleich am Anfang der Begriff „Steuerschuldner“ auf. Dennoch ist auch dieser Bescheid keine Aufforderung, eine Grundsteuer zu zahlen. Hier wird anhand des Grundsteuerwertes und einer so genannten Steuermesszahl – eine gesetzlich festgelegte Zahl, die sich nach der Art des Grundstücks und dessen Nutzung richtet – der Steuermessbetrag berechnet.
So gibt es bei Wohnnutzung beispielsweise eine Ermäßigung. Der Steuermessbetrag wird dann den Kommunen mitgeteilt. Diese legen einen Hebesatz fest und teilen ihren Einwohnern mit, was sie künftig an Grundsteuer zu zahlen haben.
Und was fängt man mit diesen Bescheiden dann überhaupt an?
Zunächst sollte man prüfen, ob die Angaben darauf korrekt sind – und falls nicht, die korrekten Daten an das Finanzamt übermitteln. Das ist über die Elster-Plattform möglich und sollte unter Angabe des Aktenzeichens erfolgen. Grundsätzlich gilt eine Einspruchsfrist von vier Wochen. Wenn alles passt, kann man die Bescheide abheften und bis zum Jahr 2025 warten – denn erst ab dann gilt die neue Grundsteuer.
Wann und wie erfährt man, wie viel Grundsteuer man künftig zahlen muss?
Die Finanzämter haben das laufende Jahr über Zeit, die Grundsteuererklärungen zu bearbeiten und die Bescheide zu verschicken. Sobald die Kommunen ab 2024 alle Bescheide vorliegen haben, können sie anhand der Steuermessbeträge die neuen Hebesätze festlegen – und sie dann irgendwann im Laufe des Jahres 2024 den Bürgern mitteilen.
Was hat es mit diesen Hebesätzen auf sich?
Die Grundsteuer ist für die Kommunen eine wichtige und vor allem gut plan- sowie steuerbare Einnahmequelle. Denn wie hoch die Grundsteuer ist, die Bürger bezahlen müssen, hängt neben dem Steuermessbetrag vom so genannten Hebesatz ab. „Diesen Faktor können die Kommunen von der Höhe her theoretisch völlig frei festlegen und zwar jedes Jahr neu“, sagt Patrick Holl, der als Erster Beigeordneter des Gemeindetages Baden-Württemberg für Finanzangelegenheiten zuständig ist. Wie hoch dieser Hebesatz dann gewählt wird, hängt davon ab, welche Ausgaben und welche anderen Einnahmen die jeweilige Gemeinde hat.
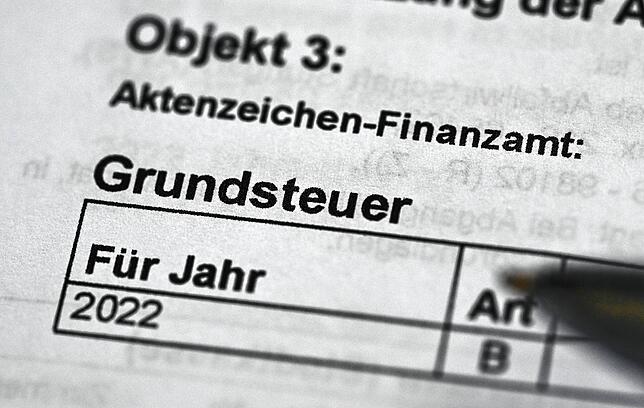
Ist zu erwarten, dass die Hebesätze die Grundsteuer für die Bürger teurer machen?
Die Kommunen haben die politische Vorgabe erhalten, dass die Grundsteuer auch nach der Reform aufkommensneutral sein soll. Das bedeutet: Die Gemeinden sollen durch die Änderung nicht mehr oder weniger einnehmen, als es vorher der Fall war. Für einzelne Grundbesitzer kann sich jedoch durchaus eine Mehrbelastung ergeben.
„Es wird sicher zu Belastungsverschiebungen kommen. Das liegt allerdings weniger an den Hebesätzen, sondern vielmehr an der geänderten Berechnung des Grundsteuerwertes“, sagt Patrick Holl. Da die Grundstücksgröße nun eine größere Rolle bei der Berechnung spielt, werden die Kosten für ein Einfamilienhaus auf einem großen Grundstück steigen, für ein Mehrfamilienhaus dagegen eher sinken.
Auch die Bodenrichtwerte spielen eine zentrale Rolle bei der Berechnung. Sie sind die letzten Jahre stark gestiegen. Macht das die Grundsteuer teurer?
„Verkaufspreise in einem Wohngebiet haben einen Einfluss auf die Höhe der Bodenrichtwerte“, sagt Patrick Holl. Dadurch, dass die Immobilienpreise in vielen Regionen die letzten Jahre stark gestiegen sind, gilt das auch für die Bodenrichtwerte.
Wie die Entwicklung für das eigene Grundstück im Vergleich zu den vergangenen Jahren ist, lässt sich auf dem Portal Boris-BW ablesen. Wer hier seine Adresse eingibt, kann auf einer Zeitleiste rechts die Werte für die Jahre 2017 bis 2022 abrufen – sofern die jeweilige Kommune diese hinterlegt hat.
„Man muss den Bürgern aber die Sorge nehmen, dass diese gestiegenen Bodenrichtwerte nun automatisch zu einer höheren Grundsteuer führen werden“, sagt Ulf Jackisch, Leiter der Zentralen Geschäftsstelle für Grundstückswertermittlung beim Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg. Der Grund: Die Kommunen sind angehalten, dass die Grundsteuer aufkommensneutral bleibt.
Würde man nun bei einem höheren Bodenrichtwert den gleichen Hebesatz wie früher zu Grunde legen, würden die Gemeinden mehr Geld einnehmen – und genau das soll ja nicht passieren.
Kann man jetzt schon irgendwie herausfinden, ob man selbst mehr zahlen muss als bisher?
Nein. Man kann zwar die Bodenrichtwerte für das eigene Grundstück wie oben beschrieben in der Historie ablesen – also sehen, wie sich der Wert entwickelt hat. Da die Hebesätze der Kommunen aber eben noch nicht feststehen, lässt sich daraus nicht schließen, wie sich das auf die Höhe der Grundsteuer auswirkt. Einzige Tendenz: Die Größe des Grundstücks spielt bei der Berechnung künftig eine größere Rolle, weshalb Besitzer großer Grundstücke mit Einfamilienhaus vermutlich künftig mehr zahlen müssen als bisher.







