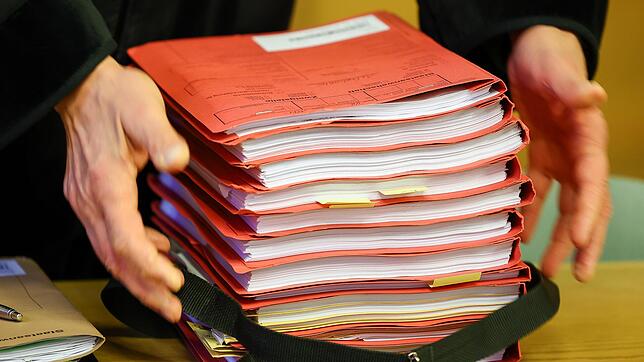Der Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist in Deutschland so ausgeprägt wie in wenigen anderen Ländern. Ausdruck des arbeitsrechtlichen Schutzes ist auch das Günstigkeitsprinzip, welches dogmatisch anerkannt ist. Es schützt Beschäftigte in zahlreichen Fällen und ist in Tarifverträgen und unterschiedlichen Gesetzen verankert. Wie genau Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von dem Prinzip profitieren können, erfahren Sie im Folgenden.
Definition: Was ist das Günstigkeitsprinzip?
Beim Günstigkeitsprinzip handelt es sich um eine rechtswissenschaftliche Kollisionsregel, die bei einem Konflikt zwischen zwei anwendbaren arbeitsrechtlichen Regelungen zum Einsatz kommt. Es ist in Paragraf 4 (Absatz 3) im Tarifvertragsgesetz (TVG) festgehalten und soll verhindern, dass von den Regelungen eines Tarifvertrags zugunsten des Arbeitgebers abgewichen werden darf. Im Umkehrschluss bedeutet das: Durch das Günstigkeitsprinzip soll ein wirksamer Schutz der Tarifbeschäftigten vor nachteiligen betrieblichen und einzelvertraglichen Regelungen geschaffen werden.
Sobald das Günstigkeitsprinzip gefragt ist, ist für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die jeweils günstigere Regelung anzuwenden. Mit einer Ausnahme: Eine Abweichung vom Tarifvertrag ist in ebendiesem ausdrücklich vorgesehen. Das nennt man eine Öffnungsklausel.
Laut dem DBB-Beamtenbund und Tarifunion ist das Günstigkeitsprinzip auf den „normhierarchischen Vorrang“ des Tarifvertrages vor den Regelungen „rangniederer Vorschriften“. Dabei kann es sich um einen Arbeitsvertrag, eine Betriebsvereinbarung, eine betriebliche Übung oder eine Regelungsabrede handeln.
Übrigens: Wer wegen Glätte, Schnee oder Eis zu spät zur Arbeit kommt, muss mit Konsequenzen rechnen. Da hilft auch kein Gültigkeitsprinzip.
Wie wird das Günstigkeitsprinzip angewendet?
Der DBB-Beamtenbund und Tarifunion stellt klar, dass die Anwendung des Günstigkeitsprinzips im Einzelfall schwierig sein kann. Wenn es nicht offensichtlich ist, ob sich eine betriebliche oder vertragliche Vereinbarung ungünstiger oder günstiger als die tariflich festgelegte Regel darstellt, wird demnach ein Günstigkeitsvergleich durchgeführt. Ein solcher kann in drei Schritte untergliedert werden.
-
Die zu vergleichenden Regelungen im Arbeits- und Tarifvertrag werden ermittelt. Handelt es sich um mehrere Regelungen, werden Vergleichsgruppen erstellt, in denen innere Zusammenhänge berücksichtigt werden.
-
Beurteilung nach objektiven Kriterien der Gesamtrechtsordnung aus der Perspektive einer oder eines Arbeitnehmenden (nicht aus der Perspektive der betroffenen Arbeitnehmerin oder des betroffenen Arbeitnehmers). Neben dem aktuellen Zustand wird auch ein langfristiger Zeitraum betrachtet.
-
Gibt es Zweifel daran, dass die arbeitsvertragliche Regelung für die Arbeitnehmerin oder für den Arbeitnehmer günstiger ist, gilt die tarifliche Vorschrift weiterhin.
Das Bundesarbeitsgericht sieht in seiner Rechtsprechung vor, das Gültigkeitsprinzip nur dann anzuwenden, wenn sich die verglichenen Regelkomplexe nach dem Vergleich als zweifelsfrei günstiger für die Arbeitnehmerin oder den Arbeitnehmer entpuppt hat.
Günstigkeitsprinzip: Beispiel aus dem Arbeitsrecht
Ein Beispiel hilft zum besseren Verständnis. Das Bundesarbeitsgericht hat im Jahr 2015 in einer Pressemitteilung einen Fall geschildert, der in seinem Bereich als Präzedenzfall gelten kann. Ein Mitarbeiter der Telekom berief sich auf eine aus seiner Sicht günstigere Regelung in seinem Arbeitsvertrag. Dieser sah eine 34-Stunden-Woche vor, im Tarifvertrag war eine 38-Stunden-Woche festgelegt. Was nach einem klaren Fall aussieht, war letztlich nicht ganz so klar.
Das Bundesarbeitsgericht wies die Klage des Mitarbeiters letztlich ab, da die kürzere Arbeitswoche mit einem geringeren Entgelt verbunden war als die längere Arbeitswoche. Die erhöhte Arbeitszeit wurde also vergütet. Hierbei ist gut zu erkennen, dass alle objektiven Kriterien herangezogen werden müssen – und Entscheidungen nach dem Günstigkeitsprinzip komplex sein können.
Übrigens: Überstunden verlangen darf ein Arbeitgeber von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht.