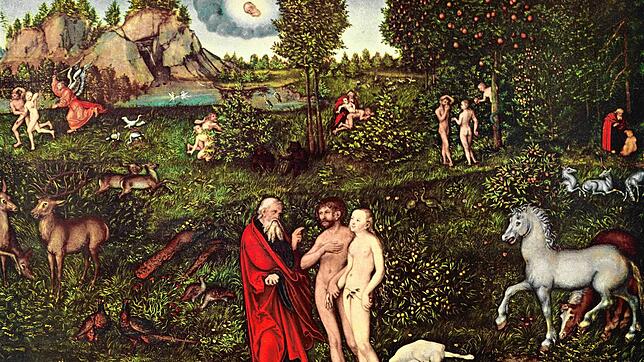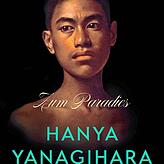Wer von Wänden eingeschlossen ist, sitzt nicht zwangsläufig in Gefangenschaft, sondern womöglich im Garten Eden. „Eine Mauer, die rundum verläuft“, so erklärt sich schließlich die ursprüngliche Bedeutung des griechischen Wortes „Paradies“. Und genau danach streben ja die meisten Menschen, ob sie nun ein himmlisches meinen oder eines auf Erden. Wie also kommen wir dorthin?
Hanya Yanagihara hat darüber einen Roman geschrieben. „Zum Paradies“ (Claassen Verlag) erzählt von menschlichen Hoffnungen und ihren Grenzen in drei Epochen. Es sind Geschichten, die auf merkwürdige Weise miteinander verwandt und doch grundverschieden sind. Verwandt in ihrer Orientierung an aktuellen Themen wie Gleichberechtigung und Bürgerrechte, verschieden vor allem in ihrer Qualität.
Der fulminante Beginn: ein Stück frappierend echt anmutender amerikanischer Zeitgeschichte aus jener Zeit im ausgehenden 19. Jahrhundert, als in den nördlichen Bundesstaaten der USA ja tatsächlich weitaus liberalere Bestimmungen vorherrschten als im konservativen Süden. So liberal, dass sogar in New York gleichgeschlechtliche Ehen erlaubt waren?
Nein, so weit reichte die Toleranz in Wahrheit nicht. Doch Yanagihara erzählt davon in einer solch beiläufigen Selbstverständlichkeit, dass man die Fiktion für historisch verbürgt halten möchte: Da ist der junge David aus der Bentham-Dynastie, sein Großvater und Vormund möchte ihn mit einem verlässlichen Geschäftsmann verheiraten. Doch wie es so ist mit arrangierten Ehen, just im entscheidenden Moment durchkreuzt ein Kandidat alle Pläne, der statt guter Sitten durch Charme und Schönheit besticht.
Mag der schöne Edward auch mittellos sein, so bringt dieser Umstand erst recht Davids Leidenschaft zum Glühen. Verbotene Liebe ist besonders heiß: Sein Großvater, der auf den Schönling sogar einen Detektiv ansetzt, hat von diesem Romeo-und-Julia-Effekt offenbar noch nichts gehört. Zwar befördert der Ermittlungsbericht tatsächlich eine Persönlichkeit mit fragwürdiger Vergangenheit zutage: Anscheinend geht David einem Erbschleicher auf den Leim. Leider jedoch interessiert sich Liebe nur selten für Ermittlungsberichte.
Berauschend modernes 19. Jahrhundert
So berauschend modern dieses fiktive 19. Jahrhundert anmutet, so deutlich schält sich darin die Erkenntnis heraus, dass liberale Denkungsart allein nicht vor den Problemen des Menschseins schützt. Den uns innewohnenden Widerspruch aus sinnlichem Begehren und praktischer Vernunft etwa löst auch keine noch so gerechte Gesellschaftsordnung auf. Und bei allem Respekt vor homosexuellen Partnerschaften bleiben Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in Yanagiharas Freistaat noch ebenso so fest verwurzelt zu sein wie ein tradiertes Standesdenken.
Fortschritt und Toleranz, wird es viel später in diesem Buch heißen, erzeuge eben nicht zwangsläufig mehr Fortschritt und Toleranz. Denn was Fortschritt überhaupt ist und welche Toleranz ihm dient, ist vor allem eine Frage der Perspektive. Ein gemeinsames Paradies für die gesamte Menschheit, muss David erkennen, ist deshalb eine absurde Vorstellung. In einer Welt, in der für den einen das Himmelreich aus Eiscreme besteht, für den anderen aber aus Kuchen: Wie sollte es da einen Ort geben, der alle Träume gleichermaßen erfüllt?
Wie Yanagihara von diesem allmählichen Erkenntnisprozess erzählt, wie sie ihre Figuren im Stil eines Henry James (nicht umsonst spielen alle drei Geschichten am Washington Square) psychologisch durchdringt, das ist bis hierhin ein literarisches Erlebnis. Sie hätte es dabei belassen können.
Geschichte Nummer zwei nämlich spielt nun in den 90er-Jahren. Wieder befinden wir uns in einem gehobenem Milieu, wieder spielt sich eine Beziehung zwischen einem reichen und einem armen Mann ab: er erfolgreicher Staranwalt, er einfacher Kanzleigehilfe. Und erneut werden innerhalb der vermeintlichen Freiheit verborgene Unfreiheiten sichtbar. Da sind die Unterschiede im Alter und Einkommen, vor allem aber auch in der Herkunft. Der kleine Gehilfe nämlich ist in Wahrheit Nachkomme des letzten Königs von Hawaii: Wäre Geschichte gerecht, begegneten die Männer einander auf Augenhöhe. Die Frage ist jedoch, ob sie sich dann überhaupt gefunden hätten.
Die Autorin erörtert diese Frage mit detaillierten Erfahrungsberichten aus der Annexion ihres pazifischen Heimatstaates, verliert sich in der von ihr konstruierten hawaiianischen Familiensaga. Ein Brief des alten, bereits erblindeten Vaters an seinen Sohn erstreckt sich über mehr als hundert Seiten, ja, das zieht sich.
Und schließlich das längste und wohl umstrittenste Schlussstück: Wir befinden uns nun einer fernen Zukunft, das Jahr 2093, geprägt von der unerträglichen Hitze des Klimawandels sowie ständig wiederkehrenden Pandemien. Der Bericht einer seltsam roboterhaften Ich-Erzählerin wechselt sich ab mit Briefen, die 50 Jahre zuvor geschrieben worden sind.
Ein Wissenschaftler äußert sich darin besorgt über die pandemischen Lagen seiner Zeit und die notwendigen staatlichen Eingriffe ins alltägliche Leben. Nach und nach beginnen wir zu verstehen: Zwischen dem Briefeschreiber von gestern und der Ich-Erzählerin von heute besteht eine Verwandtschaft. Der roboterhafte Duktus ist Folge einer schweren Erkrankung, die Enkelin überlebte eine Pandemie, die ihr Großvater nicht verhindern konnte.
Nah dran an Verschwörungstheorien
Man hat Yanagihara vorgeworfen, mit ihrer Dystopie ins Horn der Verschwörungstheoriker zu stoßen. Ihre „Mutmaßungen über den Staat, Politik, Wissenschaft“ sei ein „Kalkül mit dem Skandal“, schreibt die Wochenzeitung „Die Zeit“. Doch mit Skandalen zu kalkulieren, ist das ureigenste Vorrecht der Literatur. Allein, damit das Kalkül auch sein Ziel erreicht, müsste es Interesse erwecken, unterhalten, wenigstens glaubhaft wirken.
Im vorliegenden Fall passt schon die Briefform mit penibel notiertem Datum kaum mehr ins Bild einer künftigen Gesellschaft, die bereits heute kaum mehr anders kommuniziert als über Kurznachrichten. Die wild ausgemalten Szenarien einer um nahezu alle Bürgerrechte beraubten autoritär geführten Gesellschaft wirken derart abgegriffen, abgekupfert aus dem Reservoir altbekannter Zukunftsromane, dass die darin weitergesponnenen Überlegungen zu Paradiesvorstellungen schlicht untergehen.
Gleichgeschlechtliche Ehen sind in dieser Zukunft übrigens wieder abgeschafft, und zwar aus „geradezu besorgniserregend rationalen“ Gründen. Eine allgemeingültige Moral, so legt uns dieses Buch nahe, existiert ebenso wenig wie ein gemeinsames Paradies. Der Mensch wird trotzdem nicht aufgeben, nach beidem zu suchen.
Hanya Yanagihara: „Zum Paradies“, Roman, übers. v. Stephan Kleiner, Claassen 2022: 896 Seiten, 30 Euro.