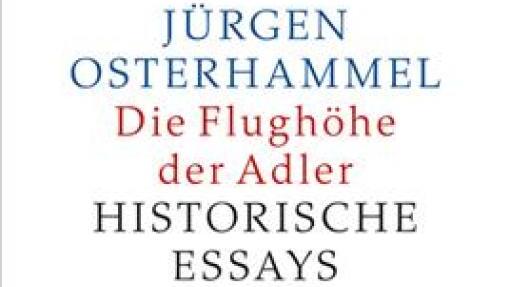Der Titel des neuen Essaybandes des Konstanzer Historikers Jürgen Osterhammel mag dem Leser im ersten Moment hochnäsig oder auftrumpfend vorkommen. Hat die Öffnung auch der Geschichtswissenschaft für globale Entwicklungen und Zusammenhänge dergleichen nötig? Immer noch? In Wahrheit deutet der Titel aber auf das grade Gegenteil: auf Bescheidenheit, auf die Anerkennung sehr viel früherer Leistungen.
Das Bild vom Adler und seinem Länder und Grenzen überschreitenden Blickfeld stammt, wie der Autor im Schlussteil des Bandes zeigt, aus dem noch jungen 19. Jahrhundert, aus der Gedankenwelt Friedrich Hölderlins, die hier in behutsamer Weise mit den bis nach Lateinamerika ausgreifenden Forschungen des großen Naturwissenschaftlers Alexander von Humboldt zusammengedacht werden. Immer wieder trifft man in den hier versammelten Arbeiten auf diese Haltung des Respekts für die Pioniere einer über Europa hinausgehenden Welterkundung und Historie: wie den Weltreisenden Georg Forster oder den Universalhistoriker August Ludwig von Schlözer im späten 18. Jahrhundert.
In diesem Stil und Gestus uneitler Selbstrelativierung ist die ganze Aufsatzsammlung gehalten. Auch und gerade dort, wo es nicht um bedeutende Vorläufer geht, als deren Erbe man sich sehen kann, sondern ganz unfeierlich um den heutigen Forschungsstand. Um seine Vorläufigkeit, seine Unabgeschlossenheit, seine Unreife, seine noch überall erkennbaren Grenzen. In Verbindung mit der sprachlichen Eleganz und Geschliffenheit dieser Texte erhält der Leser, auch der Laie, so eine Chance des uneingeschüchterten, gelösten, inspirierten Lernens. Er kann mitdenken. Es kommt echte Neugier auf.
Distanz und Reflektiertheit haben nichts mit mangelnder Überzeugung zu tun. Ein Beispiel dafür, wie die entschiedene Aussage, die pointierte historische These hier aus der bereitwillig zugelassenen Skepsis dem eigenen Tun gegenüber entspringt, ist etwa ein Vortrag, den Osterhammel zum 60. Geburtstag der Bundeskanzlerin gehalten hat. Nach schon fast verspielt anmutenden zweiflerischen oder erkenntniskritischen Anmerkungen über die Zunft und ihr Bemühen folgen dann Schlag auf Schlag dezidiert umrissene Fallbeispiele für die Produktivität und Unverzichtbarkeit von Weltgeschichte. So etwa die Französische Revolution, die unverstanden bleibt, solange man nicht „über Frankreichs Grenzen hinausblickt“ und sie „in einen europäischen Zusammenhang mit atlantischer und asiatischer Erweiterung einordnet“.
Die Reihe überfälliger geschichtswissenschaftlicher Revisionen ließe sich fortsetzen. Wie anderswo im Buch demonstriert, gehört auch der Kalte Krieg hierher: „Überhaupt – und das wäre der Clou einer globalhistorischen Neuinterpretation des Kalten Krieges – waren Asien, Afrika und Lateinamerika nicht bloß Nebenschauplätze einer nordatlantischen ‚Systemkonkurrenz’, sondern von Anfang an zentrale Arenen weltpolitischer Konflikte, die von den Supermächten niemals beherrscht werden konnten.“
Aber das so gebrochene, ernüchterte wie leidenschaftliche Plädoyer für eine global aufgeschlossene Geschichtswissenschaft erschließt sich noch ganz andere Dimensionen. Vereinfacht ließe sich sagen: Aus dem Verzicht auf allzu selbstgewisse Prognosen, die heute nur noch absurd sind – auf anmaßende, scheinwissenschaftliche Weissagungen über die Zukunft unserer Welt – entstehen hier Ansätze und Entwürfe einer neuen Ideengeschichte. „Historische Essays zur globalen Gegenwart“, so lautet der Untertitel des Buches. Und diese Gegenwart ist – ganz anders als es unmittelbar nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Ende des Kalten Krieges für kurze Zeit erscheinen konnte – unleugbar von diversen Krisen, Gewaltexzessen, Formen von Staatszerfall und Menschheitskatastrophen erschüttert und verwüstet.
Die schon frohgemut für beendet erklärte Geschichte ist auf höchst grausame Art zurückgekehrt. Die Zukunft ist unberechenbar und unvorhersehbar geworden, was jeder linear und zuversichtlich gedachten Vorstellung von „Globalisierung“, von einem Zusammenwachsen der Welt, von einer schrittweise erreichbaren besseren, nach oben ausgeglicheneren, gerechteren Lage der gesamten Menschheit bis auf Weiteres den Boden entzieht. Osterhammel stellt sich dieser Realität. Das macht die Geistesgegenwart der hier angezeigten Essays aus. Wir haben hier nicht die Selbstpräsentation einer wissenschaftlichen Disziplin vor uns, die sich partout zu verteidigen sucht, die sich auf Biegen und Brechen zu retten versucht. Sondern die Stellungnahmen eines Bürgers, eines Betroffenen, der auch noch Historiker ist.
Ideengeschichte: auch die Verfinsterung der Welt kann gedankliche Früchte zeitigen. Gerade aus der Desillusionierung der ursprünglichen, oft noch stark optimistisch gefärbten Globalisierungsvisionen kann der Anstoß kommen, neu – freier, umfassender, schonungsloser als bisher – auf unser Selbstverständnis in Europa, im „Westen“ und auf unsere Wahrnehmung der anderen zu blicken. Und umkehrt auch darauf, wie die anderen uns sahen und sehen. Es wäre dies eine gewissermaßen zweiseitige, mehrseitige Geistesgeschichte neuen Zuschnitts und Horizonts. Hervorzuheben sind hier die beiden Essays: „Was war und ist ‚der Westen’? Zur Mehrdeutigkeit eines Konfrontationsbegriffs“ (zuerst 2011) und „Der ‚Aufstieg Asiens’. Ideengeschichtliche Voraussetzungen heutiger Ungewissheit“. Vielleicht sollte der Leser überhaupt mit ihnen anfangen. Dann blickt er in eine Werkstatt der Geschichtsschreibung. Dann sieht er selbst, wie erhellend eine – ungeachtet aller aktuellen Sorgen der Europäer um sich selbst – nicht länger eurozentrisch bestimmte ideengeschichtliche Begriffs – und Typenbildung sein kann. Wenn sie wie hier ernst macht mit der alten Einsicht, dass es keinen Wertunterschied zwischen den Menschen gibt.
Auch der wohl irritierendsten Frage der gegenwärtigen internationalen Politik weicht der Autor nicht aus: Wie weit geht die Verantwortung der „internationalen Gemeinschaft“, wenn ein Staat die eigenen Bürger systematisch verfolgt und vernichtet? Reicht sie bis zur militärischen Intervention zur Verteidigung der Menschenrechte, zum Schutz der an Leib und Leben bedrohten Zivilbevölkerung? Das ist im Rahmen von historischen Essays eine mutige Entscheidung. Aber wenn man sie trifft, muss man sich auch an den auf diesem Feld einzufordernden Maßstäben messen lassen. Auch hier hält sich Jürgen Osterhammel an die Maxime seines Schreibens: Zurückhaltung, leise Töne sind besser als laute.
Jürgen Osterhammel: "Die Flughöhe der Adler". Historische Essays zur globalen Gegenwart. C.H. Beck Verlag, München. 300 S., 19,95 Euro.