Frau Held, wo sind Ihre vier Pflegekinder jetzt, während wir telefonieren?
Sie sind alle im unteren Stockwerk. Ich habe Tag und Nacht zwei Krankenschwestern im Haus wegen meiner beiden Intensivkinder. Sie sind so lieb und schauen jetzt gerade auch auf die beiden anderen.
Eines Ihrer Pflegekinder ist Richard, der heute sieben Jahre alt ist. Wie kam er zu Ihnen?
Richard ist mit 2,4 Promille Blutalkohol in der Badewanne eines Bordells schwer behindert zur Welt gekommen. Seine leibliche Mutter ist ausländischer Herkunft mit ungesichertem Aufenthaltsstatus und ohne Krankenversicherung. Es war in der 26. Schwangerschaftswoche. Er wog nicht mal ein Kilogramm, und es war nicht sicher, ob er die ersten Tage überlebt: Er bekam Krämpfe und durchlitt einen kalten Entzug von Heroin, Alkohol und anderen Drogen. Der Entwöhnungsprozess ist besonders heikel, weil man nicht weiß, ob das Gehirn eines so kleinen Kindes das schafft oder ob es sterben wird. Das Glück war, dass Richards Vormund eine Arbeitskollegin hatte, die mich kannte. Sie hat als Sozialpädagogin zeitweise eines meiner Pflegekinder betreut.

Sie haben ihn dann, als er sieben Monate alt war, zu sich genommen.
Ja, bis dahin hatte er noch nicht einmal die Sonne gesehen. Heute ist er sieben Jahre alt und kommt demnächst in die Schule. Über einen langen Schlauch ist er permanent an einen Sauerstofftank angeschlossen. Ohne ihn würde er nicht überleben. Er ist Autist und spricht nicht. Wir verständigen uns über Gebärden und Piktogramme. Das sind Bildsymbole, mit denen Richard mit uns kommuniziert.

Kann ein Heim eine solch intensive Pflege wie bei Richard, der ja ohne ständige Sauerstoffzufuhr sterben würde, überhaupt leisten?
Das ist in der Tat höchst problematisch. Als Neugeborene leben diese Kinder zum Teil mehr als ein Jahr auf der Intensivstation einer Klinik, weil sie so schwer betroffen sind und es keinen Ort gibt, wo sie hin können. Intensivpflege-Einrichtungen für solche kleinen Kinder gibt es nur äußerst selten.
Manche Familien, die ein behindertes Kind bekommen, müssen sich schweren Herzens auch eingestehen, dass sie ihr Kind nicht versorgen können. Wie war das bei Jonathan?
Er erlitt nach der Geburt einen schweren Sauerstoffmangel und wurde lange reanimiert. Dadurch wurde sein Hirnstamm schwer geschädigt. Er kann nicht schlucken, seine Atmung ist erschwert, immer wieder hat er auch Spastiken. Nachts schläft er nur zwei Stunden am Stück, dann ist er wieder für 1,5 Stunden wach. Seine Mutter kommt ihn mit der ganzen Familie immer besuchen. Sie war jetzt mit ihrem Mann und den beiden anderen Kindern für acht Tage da. Das ist immer eine anstrengend-schöne Zeit.
So verlieren sie den Kontakt nicht zu ihrem Kind, wissen es aber bei Ihnen in guten Händen.
Ja, ich denke schon. Auch Lotta war so ein Kind. Sie starb mit zwei Jahren in meinen Armen. Sie kam zu früh zur Welt und infizierte sich mit einem multiresistenten Keim. Ihre Eltern hatten noch ein Kleinkind zu Hause, lebten im dritten Stock eines Mietshauses in Köln. Sie war Erzieherin und ist heute auch alleinerziehend. Hinzu kam die Trauer und die Überforderung mit einem solch pflegebedürftigen Kind. Man braucht 24 Stunden einen Intensivpflegedienst in der Wohnung. Von Privatsphäre keine Spur mehr. Lottas Mutter sagte: Durch die Pflegefamilie habe ich mein Kind wieder bekommen. Sie durfte ihr Baby im geschützten Rahmen erleben mit Begleitung durch den Pflegedienst und durch mich. Sie durfte aber auch sagen: „Ich kann nicht mehr“ und die Kleine wieder abgeben. Auch Jonathans Mutter hat das so gemacht. Die Mütter weinen viel, trauern um ihre Kinder, sind aber gleichzeitig unendlich dankbar, dass die Kleinen bei uns sein können.
Jedes Kind hat ein Recht auf Familie
Dass Kinder mit Behinderung in eine Pflegefamilie kommen, ist in Deutschland eher dem Zufall überlassen, weil es nicht gesetzlich geregelt ist.
Im Moment ist man davon abhängig, ob der Sozialarbeiter diese Hilfeform kennt und auch unterstützt. Im achten Sozialgesetzbuch gibt es nur seelisch behinderte Kinder, aber keine geistig und körperlich behinderten Kinder.
Was hat das für Folgen?
Ämter stufen Kinder immer noch nach dem Intelligenzquotienten ein. So passiert es, dass Kinder mit einem IQ unter 70 in die Zuständigkeit des Sozialamts fallen und keine Hilfen zur Erziehung bekommen. Das Jugendamt hat dann keine Leistungsverantwortung. Durch unsere Arbeit als Bundesverband behinderter Pflegekinder hat sich das etwas verbessert, doch nach wie vor kennen viele Ämter die Möglichkeit einer Pflegefamilie nicht. Ethisch ist das nur schwer vertretbar, von Inklusion kann hier keine Rede sein.
Sie haben nie eigene Kinder bekommen und kümmern sich liebevoll um diese Kinder, die sonst keine Chance gehabt hätten. Warum?
Meine Schwester kam mit spinaler Muskelatrophie zur Welt, einer Muskelerkrankung, die in der Regel mit einer sehr geringen Lebenserwartung einhergeht. Hätte ich eigene Kinder bekommen, hätte ich die Krankheit an sie weitergeben können.

Jonathan, Richard und Cora könnten ohne die Pflegekräfte nicht bei Ihnen leben. Bekommen Sie den Mangel an Pflegekräften zu spüren?
Und wie. Ich habe mich deshalb für das Arbeitgebermodell entschieden. Das heißt, die Krankenkasse zahlt die Intensivpflege für Jonathan, Richard und Cora nicht mehr an einen Pflegedienst, die mir das Personal dann zur Verfügung stellen. Stattdessen zahlt die Kasse einen weitaus geringeren Stundensatz an mich, als Vormündin der Kinder. Diesen gebe ich eins zu eins weiter. Ich stelle dann die Fachkräfte ein. Früher passierte es, dass mich der Pflegedienst mittags anrief und sagte, heute Abend kommt um 19 Uhr kein Nachtdienst. Ich hatte zum Teil 30 verschiedene Mitarbeiter hier. Das war weder für die Kinder noch für mich tragbar. Heute habe ich 14 Pflegekräfte in Teilzeit und Vollzeit.
Wie kam es, dass Sie sich für ein Leben mit Pflegekindern entschlossen haben?
Mein damaliger Mann hat nach einem Besuchswochenende mit Sascha gesagt: Ich kann ihn nicht mehr ins Heim bringen, ich setz mich mit ihm nach Tahiti ab. Der Abschied fiel uns so schwer und Sascha weinte jedesmal. Ich war damals 25 Jahre alt, Sascha 14. Ich hatte ihn kennengelernt, als ich mit 16 in einem Kinderheim arbeitete.

Wie schwer war es, Sascha aufzunehmen?
Das war ein Kraftakt. Er hatte 14 Jahre in einem Heim gelebt. Und jetzt kamen wir und brachten diese Regelung durcheinander. Ich erwirkte eine Bundestagspetition und erreichte, dass Menschen wie ich behinderte Pflegekinder aufnehmen dürfen, die zuvor in Heimen lebten. Häufig zählen erst wirtschaftliche Argumente, um ein Gesetz zu erwirken. So können Pflegefamilien auf 10 Kinder bis zur Volljährigkeit, bis zu 2 Millionen Euro Steuergelder sparen. Auch das Arbeitgebermodell der Intensivpflege erspart dem Sozialversicherungsträger allein in meinem Fall 290.000 Euro pro Jahr.
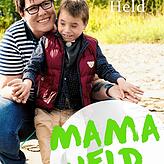
Was müsste sich Ihrer Ansicht nach konkret ändern?
Kinder mit Behinderung müssten in die Kinder- und Jugendhilfe aufgenommen werden. Auch diese Kinder haben ein Recht auf Erziehung und auf Kindsein mit allen Hilfen. Bisher gibt es keine bundeseinheitliche Regelung. Die Unterbringung in einer Pflegefamilie ist nach wie vor eine Einzelfallentscheidung und die Unterstützung Verhandlungsbasis.








