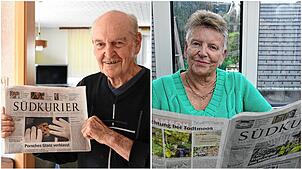Mindestens einmal im Jahr rückt Jerusalem in den Mittelpunkt. Am Karfreitag richten sich viele Blicke auf die Via Dolorosa in der verwinkelten Innenstadt. Über die „Straße des Schmerzes“ hat Jesus nach christlicher Überlieferung sein Kreuz getragen. Um daran zu erinnern, schleppen Pilger aus aller Welt kleine oder große Kreuze durch die Via Dolorosa, begleitet von Betenden. Das hölzerne Marterwerkzeug leihen sie meistens bei arabischen Händlern aus. Mit etwas Verhandlungsgeschick gewähren diese Rabatt oder geben eine Dornenkrone aus Plastik drauf. An vielen Ständen des Basars wird symbolisches Foltermaterial angeboten.
Die Szene ist typisch für Jerusalem, das häufig als Heilige Stadt tituliert wird. Doch ist das nur die halbe Wahrheit. Hier treffen der Heilswillen und der Anspruch von drei Religionen aufeinander. Das geht nicht immer friedlich aus. Die Hauptstadt des Staates Israel ist Schauplatz von Machtkämpfen und widerstreitenden Interessen. Sie erinnert eher an ein Zentrum, das Unheil magisch anzieht. Mit eitlen Darstellern, die ihre Rechte eifersüchtig hüten. Wenn die Pilger längst abgezogen sind, wird hinter den dicken Mauern der historischen Altstadt weiter gerungen. Jesus hat vor knapp 2000 Jahren die Händler aus dem Tempel geworfen. Heute ginge das nicht mehr. Man würde die Polizei rufen und ihn wegen grober Sachbeschädigung und Beleidigung verhaften.

Die verschlossene Grabeskirche
Wie labil das zarte Pflänzchchen des Religionsfriedens ist, zeigte sich vor einigen Wochen. Ohne Vorwarnung hatten die Verantwortlichen die Grabeskirche geschlossen – wohl wissend, dass in der Fastenzeit viele Pilger anreisen, um den Ort zu besuchen. Es geschieht selten, dass sich die sechs Kirchen, die die Grabeskirche verwalten, einig sind. Ende Februar trat dieser Fall ein: Der Sechser-Club (Armenier, Syrer, Griechen, Katholiken, Kopten und Äthiopier) ließ den heiligen Ort zusperren. „Das hat es seit 800 Jahren nicht mehr gegeben, dass die Grabeskirche geschlossen ist“, sagt ein enttäuschter Padre Pedro im Gespräch mit dieser Zeitung. Der mexikanische Geistliche war mit seiner Gemeinde eigens angereist, um in Jerusalem zu pilgern. Und dann so etwas.

Mit diesem Streik protestieren die Kirchen gegen ein Steuergesetz, das der Staat Israel erlassen will: Auch christliche Konfessionen sollen in Zukunft Grundsteuer bezahlen, auch wenn sie sich auf ein altes Dekret berufen. Seit dem Mittelalter nämlich sind sie von Steuern befreit und privilegiert. Davon profitieren vor allem die orthodoxen Griechen, denen ganze Straßenzüge gehören.
Der Druck der zugeworfenen Tür wirkte. Israel stellt das Gesetz erst einmal zurück, und bald schon strömten die Menschen durch das einzige Portal in das mystische Innere. Das Bauwerk ist alt, es geht auf die Kaiserin Helena zurück, die vor etwa 1700 Jahren die Lebensstationen von Jesus aufsuchte, nachdem sie frisch bekehrt war. In Jerusalem suchte und fand sie das Kreuz Christi und ließ darüber eine Kirche bauen – die heutige Grabeskirche. Zwei Lebensstationen werden dort erlebbar: Golgatha als Ort der Hinrichtung und das Grab Jesu. Näher kann ein Sterblicher dem Stifter einer Weltreligion kaum kommen.

Dabei ist es mit der Annäherung schwierig. Schier unmöglich gestalten sich religiöse Handlungen und damit das, wofür diese Kirchen gebaut wurden: Gebet, Meditation, Stille. Ohne herzhaftes Drängeln erlangt man keinen Zugang. Die besten Sichtplätze nehmen ohnehin Menschen ein, die zufällig größer und vor allem breiter als man selbst sind... Wer einem der schweren Leuchter zu nahe kommt, wird bald von einem Popen zurechtgewiesen. Große Gruppen haben Vorfahrt. Von winkenden Führern werden sie mit einem bunten Regenschirm durch das Gotteshaus gelotst. So wird man Ohrenzeuge von spannenden Erklärungen, zum Beispiel in koreanischer Sprache.
Die Pilger reisen wieder ab. Mancher mag die Illusion über die Heilige Stadt verlieren. Sie entpuppt sich als Mekka der Händler, Steuereintreiber, Hoteliers. Auch damit kann man leben. Etwas anderes bedrückt mehr: der allmähliche Abzug der Christen aus Jerusalem. Der heilige Ort der drei Religionen entwickelt sich zunehmend zum Ort zweier Religionen. Immer mehr Kirchen und Wohnhäuser stehen als leere Hülle da, in der das schwache Licht irgendwann gelöscht wird.

Gespräche bestätigen diesen Befund. George Deades betreibt den Schnellimbiss „Erivan“ an der Hawalida Straße. Der armenische Christ mit israelischem Pass verkauft dort Döner, Falafel und Kaffee. Sein Lokal läuft ordentlich. Doch klagt er: „Israel benachteiligt die Christen. Meine Familie hat das Land inzwischen verlassen. Ich bin hier, noch.“ Der Druck wachse, sagt er. „Wir sind hier zwischen zwei Hämmern.“ Der eine Hammer sind die Juden als Staatsvolk, der andere die Muslime mit hoher Geburtenrate. Zwei Ecken weiter steht Ava Attata vor einem wurmstichigen Holzportal. Er ist Hausmeister am griechischen Patriarchat, von Haus aus Katholik. Attata sagt ohne langes Zaudern: „Wir sind Bürger zweiter Klasse.“
Religion, ein Wettrennen
Jerusalem im Jahre des Herrn 2018: ein Verdrängungswettberb. Jeder vierte Besucher hier ist christlicher Pilger. Dazu kommen orthodoxe Juden, die aus aller Welt anreisen und an der Klagemauer beten. Auch für sie ein heiliger Ort, wo man ebenso wie in der Grabeskirche sämtliche Sprachen der Welt hört. Die Juden, die dort beten, sind weißhäutig, rötlich, braun und schwarz. Sie haben dunkle, blaue, grüne Augen.
Der politisch heißeste Ort in dieser Metropole ist aber der Tempelberg – eine riesige Fläche, auf der früher der Tempel Salomos stand. Heute gilt er als Sammlungsort der Muslime mit dem Felsendom in der Mitte. Die hauchdünn vergoldeten Platten des Kuppeldachs bezahlte der König von Jordanien. Als Nachkomme von Mohammed gilt das als Ehrenpflicht für seine Dynastie.
Erst nach strenger Kontrolle und langem Warten werden Besucher über eine Rampe eingelassen. Die Spannung ist mit Händen zu greifen. Der Platz ist sorgsam bewacht. Wer zum ersten Mal die staubige Hochfläche betritt, staunt. Mehr Gewehre als Gebetbücher. „Israel ist die Giftküche Gottes“, meint der Reiseveranstalter Georg Rößler, der seit vielen Jahren im Land wohnt.
Das Brodeln in dieser Küche hat Tradition. Seit der Gründung der Stadt durch König David an der Stelle einer älteren Siedlung war Jerusalem stets ein Brennspiegel religiöser Differenzen. Bereits der Prophet Jesaia weissagte dem Ort eine düstere Zukunft. Er behielt recht. Die Einwohnerschaft wurde verschleppt, der Tempel mit seinen Geräten aus purem Gold geplündert. Und 700 Jahre nach Jesaia schreibt der Evangelist Lukas: „„Als Jesus die Stadt vor sich liegen sah, weinte er und sagte: Es kommt eine Zeit, da werden deine Feinde dich belagern und von allen Seiten einschließen. Sie werden dich und deine Bewohner völlig vernichten und keinen Stein auf dem andern lassen.“
Zum Pessachfest nach Jerusalem
Dennoch zog Jesus zum Passah-Fest hoch nach Jerusalem. So schrieb es die jüdische Tradition vor. Jesus war Jude. Dabei kündigten sich die langen Leiden mehrfach an. Schon früh sprach er von der Passion, die sich nur in dieser Stadt vollenden könne – nicht in der Heimat im nördlichen Galiläa. Nur im Mittelpunkt der jüdischen Hoffnung konnte er die Sache zu Ende bringen.
Warum ziehen Juden in eine Stadt, über die ihre frommen Schriften so kritisch berichten? Weil Jerusalem für etwas Gewaltiges steht. Es ist mehr Ahnung als Tatsache. Weit über die reale Stadt und deren Bewohner hinaus träumen bereits die Juden von einem messianischen Reich. Sitz dieses friedlichen Staates ist Jerusalem.
Auch die Christen nehmen das Bild des himmlischen Jerusalem in ihr Weltbild auf. In der Apokalypse, dem letzten Buch des Neuen Testaments, wird diese ideale Siedlung in leuchtenden Farben beschrieben. An nichts wird gespart, die Tore und Mauern dieser Mega-City sind mit Edelsteinen besetzt. Die aktuell existierende Stadt mit ihren Problemen dient nur als Platzhalter für Größeres. An ihrer Stelle wird eines Tages eine Utopie entstehen, in der die Religionen nicht mehr streiten und der Staat keine Steuern mehr einziehen wird. Auch der Blutfreitag, der Tag des Schmerzes, wird sich dann als Übergang erweisen. Dieser unerschöpfliche Symbolwert macht Jerusalem zu etwas Einmaligem. Schöner Wohnen auf alle Ewigkeit.
Wie sicher ist Israel?
Mancher fragt sich: Ist eine Reise nach Israel riskant? Tatsache ist: Durch den Dauerstreit zwischen Juden und Arabern zählt das Land zu den Brennpunkten. Gefährlich ist der Gaza-Streifen, der zu den palästinensischen Autonomiegebieten gehört. Deshalb taucht der Landstrich in keinem Reiseprospekt auf. Eine Fahrt dorthin wäre zu riskant, zumal es dort auch kaum Sehenswürdigkeiten gibt. Jerusalem gilt dagegen als sicher. Seit der Staatsgründung 1948 ist keinem Reisenden ein Haar gekrümmt worden. Die Erklärung: Wenn es zu Kämpfen kam, wurden Besucher bisher ausgespart, während sie in anderen Ländern gezielt als Geiseln genommen werden. (uli)

Ein Platz mit bewegter Geschichte
Auf dem Tempelberg in Jerusalem geben sich drei große Religionen die Klinke in die Hand. Das hat auch damit zu tun, dass ihre Geschichte eng verwoben ist.
-
FelsendomEr prägt mit goldener Kuppel und blauen Fliesen das Stadtbild von Jerusalem. Der Felsendom ist der älteste monumentale Sakralbau des Islams. Er ist ein Schrein, der an die Himmelfahrt des Propheten Mohammed erinnert. Der Fels, von dem aus er entrückt wurde, wird bis heute im Inneren gezeigt. In den Felsendom haben wegen seiner Brisanz nur Muslime Zutritt.
-
IntifadaIm September 2000 besuchte der damalige Oppositionsführer Sharon den Tempelberg. Er machte damit deutlich, dass der Berg auch jüdisches Erbe sei. Die Folge war katastrophal: Sharon löste mit seinem Spaziergang die zweite Intifada („Aufstand“) der Palästinenser aus.
-
VorgeschichteDer Felsendom steht auf dem riesigen Platz, den König Herodes aufschütten ließ. In dessen Mitte stand der große jüdische Tempel. Als die Muslime Jerusalem im Lauf des 7. Jahrhunderts eroberten, besetzten sie auch den Tempelberg und pflanzten dort ihre Tradtion ein. Seitdem war es „ihr“ Heiligtum. Die Juden hatten das Nachsehen.
-
TempelritterDie Christen erheben auf den Tempelberg keinen Anspruch. Sonst wäre die Situation noch diffiziler, als sie es ohnehin ist. Während der Kreuzzüge nahm der Orden der Tempelritter dort Quartier. Er nannte sich nach dem Salomonischen Tempel. Die Tempelritter rückten später zum reichsten Orden des Mittelalters auf. Deshalb ließ sie der französische König mit fadenscheinigen Gründen verfolgen, um sich ihrer Güter zu bemächtigen. Der Schriftsteller Umberto Eco hat diesem Männerbund in seinem Roman „Das Foucault’sche Pendel“ ein Denkmal gesetzt.
-
Schwaches BildGemeinsam reisten die katholischen Bischöfe und ihre evangelischen Kollegen im Oktober 2016 nach Israel. Der Besuch der deutschen Geistlichen wurde als Erfolg in der Ökumene gewertet – bis eine protokollarische Panne bekannt wurde, die auf dem Tempelberg unterlaufen war: Der muslimische Geistliche, der die Bischöfe dort führen sollte, bat sie um das Ablegen ihrer Brustkreuze. Die Deutschen leisteten dem sofort Folge, was in der Heimat für Entsetzen sorgte, zumal es keinen stichhaltigen Grund für das Leugnen ihrer christlichen Identität gab.