Was wäre unsere Sprache nur ohne den Fußball? Auf jeden Fall dürfte sie um viele Metaphern ärmer sein. Und damit sind nicht nur die berühmten Beispiele aus Politiker-Reden gemeint, wenn mal wieder ein Oppositions-Politiker davon spricht, dass nun „der Ball in der Hälfte der Regierung“ liege oder die Kanzlerin den kommenden „Elfmeter nicht verschießen“ dürfe. Nein, ganz gewöhnliche Begriffe des Sports wie „Tor“ oder „Stürmer“ verdanken sich dem Fußball.
Schuld daran war, wie sollte es anders sein, ein Mann der Sprache. Nicht etwa ein Sportler nämlich hat die britische Sporart Fußball nach Deutschland gebracht, sondern ein Intellektueller aus Braunschweig: Dr. Konrad Koch, Gymnasiallehrer für Deutsch und Alte Sprachen, wollte seine Schüler zur körperlichen Ertüchtigung an der frischen Luft ermuntern. Seine nicht ganz unbegründete Hoffnung war, dass sie hierbei den Kopf freibekommen für weitere Vokabel- und Lektürestunden.
Simple Balltreterei
Weil Sport in Deutschland allerdings damals, im 19. Jahrhundert, bislang mit Turnen in oft schlecht belüfteten Hallen gleichzusetzen war, bedurfte es eines neuen, möglichst einfach zu organisierenden Spiels. Die simple Balltreterei aus Großbritannien kam dem Lehrer gerade recht. Wie Christoph Marx nun in seiner Untersuchung über die Sprache des Fußballs („Der springende Punkt ist der Ball“) erklärt, hatte Koch aber bei ihrer Etablierung mit erheblichem Widerstand zu kämpfen.
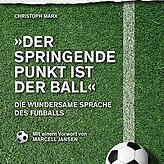
Denn was sich bei den Schülern schnell großer Beliebtheit erfreute, stieß bei Verfechtern einer deutschen Turn-Tradition auf scharfe Kritik. Insbesondere ein Stuttgarter Turnlehrer namens Karl Planck tat sich mit Polemiken gegen den Trend hervor. Allein schon, dass der Ball mit den Füßen getreten wird, war für ihn zu viel des Guten: „Was bedeutet der Fußtritt in aller Welt? Doch wohl, dass der Gegenstand, die Person nichts wert sei, dass man auch nur die Hand um ihreswillen rührte. Es ist ein Zeichen der Wegwerfung, der Geringschätzung, der Verachtung, des Ekels!“
Und nicht allein der Fußtritt brachte den einflussreichen Turn-Freund auf die Palme. Auch die dabei einzunehmende Körperhaltung war ganz und gar unmöglich: „Das Einsinken des Standbeins im Knie, die Wölbung des Schnitzbuckels, das tierische Vorstrecken des Kinns erniedrigt den Menschen zum Affen.“
Die "englische Krankheit"
Wegen all dieser unschönen Erscheinungsformen galt der Sport als „englische Krankheit“, als „Fußlümmelei“, die eines anständigen Deutschen nicht angemessen sei. Der brave Lehrer Koch hatte jede Menge zu tun, sollte seine Idee zur Beschäftigung an der frischen Luft auch bei den Patrioten Akzeptanz finden. Zuallererst galt es, deutsche Wörter zu finden.
Denn die vielen englischen Begriffe, vom „Goal“ (Tor) bis zur „Halftime“ (Halbzeit), fügten sich zu einem „widerwärtigen Kauderwelsch“, wie der Sprach-Purist befand. Dem „köstlichen Spiele“ müsse dieses „in den Augen echt vaterländisch gesinnter Männer Eintrag tun“.
Also ging der Lehrer Koch ans Werk. „Goal“, so erklärte er, sei ein gar zu hässliches Fremdwort, zumal wenn es „Johl“ gesprochen werde. Seine jungen Sportler sollten lieber „Mal“ rufen, wenn sie den Ball erfolgreich im Netz unterbringen. Allerdings zeigte sich schon bald, dass „Mal“ doch irgendwie zu zahm wirkte. „Also ersetzen wir ihn überall, wo es angeht, durch ‚Tor’.“
Liste mit Fachbegriffen
Was Konrad Koch anordnete, wurde befolgt. Schließlich ist er es gewesen, der den Fußball für die Deutschen entdeckt hatte. Deshalb durfte er sich auch herausnehmen, den bereits gegründeten Fußballvereinen im Jahr 1903 eine Liste an passenden Fachbegriffen an die Hand zu geben. Der „Forward“, so hieß es darin, sei künftig als Stürmer zu bezeichnen, der „Centre Forward“ demnach als Mittelstürmer. „Off side“ heiße fortan Abseits, und der „Penalty Kick“ sei nun ein Strafstoß.
Nicht alle von Kochs Vorschlägen sollten dauerhaft auf Gegenliebe stoßen. Der „Captain“ zum Beispiel heißt heute Kapitän. Koch hatte eigentlich die etwas skurril anmutende Kreation „Spielkaiser“ im Sinn. Auch den „Hinterspieler“ gibt es nicht: So sollte man nach Vorstellungen des Braunschweiger Lehrers die Verteidiger nennen.
Manche Begriffe setzten sich nur zur Hälfte durch. Weil das Passen vom englischen Verb „to pass“ kommt, wurden die Spieler angehalten, den Ball „abzugeben“. Heute sind beide Versionen gebräuchlich. Und den empörten Ruf „Foul!“ konnte Herr Koch den Fußballern ebensowenig abgewöhnen wie die Aufforderung zum „Fairplay“.
Schweizer Sonderweg
Überhaupt machte die Eindeutschung des Fußball-Spiels vor den Landesgrenzen Halt. Noch heute spricht man in der Schweiz vom „Match“ statt vom Spiel und liest in Zeitungen Sätze wie: „Marc Janko erzielte den einzigen Treffer nach einem Corner – unterstützt von einem Goalie-Schnitzer.“ Da dreht sich Konrad Koch im Grabe um.
In der Bundesliga wie auch in der deutschen Nationalmannschaft dagegen ist von Eckbällen und Torhütern die Rede. Und wenn man es recht bedenkt, so ist es schade, dass es nicht auch Hinterspieler und Spielkaiser gibt – unsere Sprache könnte um so manches schöne Wort reicher sein.





