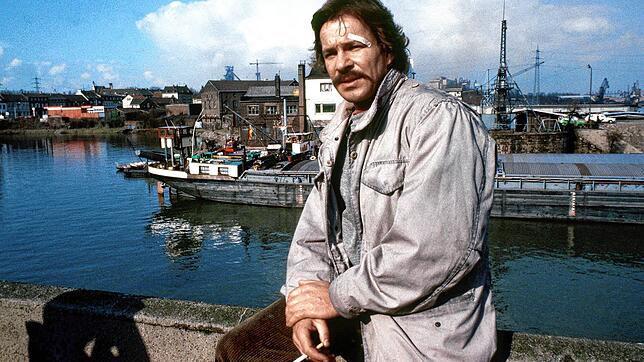Der Tatort ist begehrt. Ob es die prominenten Ermittler aus Münster sind oder Lena Odenthal aus Ludwigshafen und ihr Team, auch uralte Folgen sind beim Publikum beliebt. Um sie anschauen zu können, muss man allerdings bezahlen. Denn anders als das Angebot in der ARD-Mediathek ist das Portal kostenpflichtig. Für 4,99 Euro im Monat lassen sich auf ARD Plus neben alten Tatort-Folgen und der „Lindenstraße“ zahlreiche Filme, Serien und Dokumentationen abrufen. Es gibt auch ein großes Angebot an Kinderfilmen und -serien.
Aber warum sollen Fernsehzuschauer für Produktionen der Öffentlich-Rechtlichen eigentlich bezahlen, wenn sie doch ohnehin ihren Rundfunkbeitrag leisten müssen? Weil der Gesetzgeber es so will. Im Staatsvertrag ist festgeschrieben, was die Öffentlich-Rechtlichen dürfen – und was nicht.
Der Gesetzgeber hat das letzte Wort
„Der Gesetzgeber will mit dem dualen Rundfunksystem öffentlich-rechtliche und private Medien in Balance halten“, sagt Tanja Hüther, „das heißt auch, dass es Begrenzungen gibt für öffentlich-rechtliche Medien, wo kommerzielle Anbieter Geld verdienen.“ Sie leitet das Distributionsboard, ein Gremium der ARD, das sich damit beschäftigt, welche Inhalte wie ausgespielt werden.
Das klingt einfach, ist aber eine durchaus komplizierte und komplexe Angelegenheit. Denn wer an einer Filmproduktion beteiligt ist, hat ein Interesse daran, dass der Film oder die Serie möglichst oft verkauft wird. Deshalb schreibt der Gesetzgeber den Öffentlich-Rechtlichen vor, dass sie ihr Programm nicht unbegrenzt in ihren Mediatheken anbieten dürfen, weil die Inhalte dort kostenlos abgerufen werden und die Urheber nichts mehr daran verdienen.

Das kann einerseits die Urheberrechte betreffen, also die Rechte der schöpferisch Beteiligten wie Regisseur oder Drehbuchautor. Aber auch Sender oder Produzenten haben Rechte an der Ausstrahlung einer Produktion. Die Verweildauer ist deshalb klar geregelt und nach Genres aufgeteilt: Dokumentationen und Dokumentarfilme dürfen in der Regel länger in der Mediathek angeboten werden als Spielfilme. Auch Kultur- und Bildungsprogramme haben eine längere Verweildauer.
Diese Beschränkungen kollidieren mit den Interessen der Öffentlich-Rechtlichen, die ihrem Publikum ein möglichst großes und vielfältiges Angebot bieten wollen und sollen. Auch Zuschauer möchten keineswegs nur taufrische Produktionen sehen, sondern gern auch Klassiker, Serien und vor allem frühere Folgen vom Tatort.
Wenn TV-Filme auf DVD landen
Deshalb gab es die Highlights schon in den vergangenen Jahrzehnten auf Video und später auf DVD zu kaufen – und deshalb waren TV-Produktionen auch auf Netflix oder Amazon zu sehen. 2020 wurde ARD Plus ins Leben gerufen, wo die zeitlosen Angebote gebündelt und digital verfügbar sind. Schon jetzt stünden Tausende Titel bereit, sagt Tanja Hüther, „und es kommen immer neue dazu“.
Den Öffentlich-Rechtlichen ist es grundsätzlich erlaubt, sich auch kommerziell zu betätigen und etwa mit Werbung Geld zu verdienen oder auch mit der Verwertung von Lizenzen. Diese Verwertung von Filmrechten macht die ARD allerdings nicht selbst, sondern sie wird über Tochterunternehmen abgewickelt – zum Beispiel über die Bavaria. Sie verhandeln mit den verschiedenen Parteien. Da der Tatort zu 100 Prozent von der ARD bezahlt wird, gehören die Rechte der ARD.
Häufig teilt sich die ARD die Kosten einer Produktion aber mit externen Produzenten, die dann auch an den Rechten beteiligt sind. Wie sich diese im Detail verteilen, muss im Einzelfall geklärt werden. Wenn der Produzent zum Beispiel die Auslands-Rechte hat, können Filme oder Serien in der ARD-Mediathek nur innerhalb Deutschlands abgerufen werden.
Im Detail kann es durchaus vorkommen, dass ein Film oder eine Serie bei ARD Plus kostet und gleichzeitig kostenlos in der ARD-Mediathek steht – denn die einzelnen Sender zeigen auch Wiederholungen, die dann wiederum für eine begrenzte Zeit in der Mediathek verbleiben dürfen. Das hat bisher für die Nutzer zu manchem Durcheinander geführt, wenn BR oder MDR unterschiedliche Folgen und Staffeln von „In aller Freundschaft“ oder „Tierärztin Dr. Mertens“ vorhalten und Nutzer nicht so einfach die gewünschte Folge finden.
„Wir sind dabei, das zu sortieren und im Hintergrund so zusammenzuführen, dass alles an einem Ort auffindbar ist“, sagt Tanja Hüther. Aber auch weiterhin werden die Sender ihre eigenen Mediatheken haben. „Es ist uns wichtig, dass man die einzelnen Rundfunkanstalten und Marken noch findet, weil die Menschen nach bestimmten Sendungen und auch nach ihrem Sender suchen“, betont sie.
Die Gewinne, die die Öffentlich-Rechtlichen machen, werden in neues Programm investiert. Einen allzu großen Anteil spielen die Verwertungen allerdings nicht. Im Vergleich zu den Werbe-Erlösen, so Hüther, seien diese Einnahmen dann doch überschaubar.