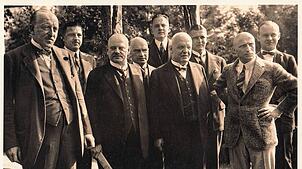Teilen macht unglücklich. Immer? Nicht immer. Augenblicke der Vollkommenheit können sich im gemeinsamen Erleben potenzieren. Sie zu teilen ist dann das Schönste, was es gibt auf der Welt. Und ja, das gilt auch für materielle Güter.
Wenn das Gegenüber eine Begierde auf ein Konsumgut zeigt, das du gerade selbst verputzt, ein Stück Kuchen oder eine gepflegte Flasche Wein, dann bereitet es Freude, ein zweites Glas aus der Küche zu holen oder mit der Gabel das Gebäck zu halbieren. Vermutlich ist diese unschuldige Freude ein Abglanz von dem Glücksgefühl, das sich einstellt, wenn es darum geht, eine Not zu lindern.
In unserer behaglichen Gegenwart des Überflusses kommt das zwar kaum noch vor. Es ist aber bezeugt durch zahllose Erzählungen von Hunger- und Elends-Situationen: Der geteilte Kanten Brot, der überlassene letzte Schluck Wasser machen das Überleben zur gemeinsamen Sache. Doch dieser Moment findet sich inzwischen als Augenblick elementarer Freude und Erfüllung so häufig geschildert, dass es bisweilen aufdringlich wirkt. Soll hier etwa der Erfolg weniger altruistischer Überlebens-Taktiken verdrängt werden?
Mindestens verhüllt diese Erzählung von der Kraft des Teilens in all ihrer rührenden Schönheit, dass sie keine Erzählung vom kollektiven Gut ist. Sie handelt im Gegenteil vom souveränen Umgang mit Eigentum: Teilen kann nur der Besitzer, Sankt Martin zum Beispiel seinen Mantel. Dem Bettler bleibt nur, die Gabe anzunehmen.
Er kann sich auch nicht beklagen: Die Hoffnung auf Almosen war ja seine eher prekäre Geschäfts- und Überlebensidee gewesen. Schön also, dass es geklappt hat! Moralisch aber gerät der Bettler damit ins Hintertreffen: Denn angeblich ist ja Geben seliger denn Nehmen.
Und so darf sich Martin im wohligen Gefühl einrichten, schön, richtig und gottgefällig gehandelt zu haben. Auch wird er Karriere machen als Bischof und später Heiliger. Er erlangt das ewige Leben. Der (vermeintliche) Profiteur seiner guten Tat dagegen? Wahrscheinlich ist er anonym beerdigt worden. In einem Grab, das er wiederum selbst teilen muss: mit anderen Armen.
Wenn das verliehene Buch verschollen bleibt
Ach, Sankt Martin ist und bleibt ein guter Mann. Aber Teilen ist nun mal ein ungenaues Wort. Manchmal, in seiner selbstlosesten Form, meint es das reine Abtreten von Besitz, ohne Gegenleistung und Hintergedanken. Das ist edel, hilfreich und bereitet Freude. Wenigstens solange man es sich leisten kann und es keine obsessiven, selbstzerstörerischen Ausmaße annimmt, wie beim Märchen von den Sterntalern, dessen Protagonistin ganz offenkundig unter der wenig erforschten Zwangsstörung der Doromanie leidet.
Ein weiteres Verständnis dieses Wortes sieht das Teilen eines gemeinsamen Besitzes vor: ein Zwingmoment für jede freundschaftliche Beziehung. Um dessen Konfliktpotenzial einzudämmen, gibt es Techniken des Zählens und Messens und Formen der Ritualisierung. „Ich will teilen / Ihr sult wählen“ beschreibt eine im 19. Jahrhundert verschriftlichte Spruchweisheit eine Möglichkeit, das nagende Unbehagen zu bekämpfen, bei diesem Prozess zu kurz gekommen zu sein.
Und schließlich ist da noch diese uralte Praxis, etwas auszuleihen oder selbst zu verleihen. Alles, was derzeit global unter dem Label der Sharing Economy verhandelt wird, also der Ökonomie des Teilens, basiert auf dieser dritten Wortbedeutung. Und hierzu lässt sich sagen: Auf individueller Ebene kann diese Praxis Quelle tiefen Unglücks werden, wenigstens aber einer missliebigen Erinnerung. Beispiel: Bücher verleihen.
Manche kehren verdreckt zurück, mit Eselsohren, mit Lesespuren. Der erfahrene Verleiher mag so etwas schon einkalkulieren. Und doch hüllt dieser Anblick das doch eigentlich freudige Ereignis der Rückgabe in einen Schleier von Traurigkeit.
Um ein Negativ-Beispiel aus der Erfahrung des Autors zu bemühen: Da war die Kommilitonin Anja, die für irgendein Rundfunk-Projekt mal schnell seine Ausgabe von Goethes „West-Östlichen Divan“ benötigte. Klar konnte sie die haben! Laut Antiquariatsgesamtverzeichnis liegt der Wert des verliehenen Exemplars aktuell bei 5,90 Euro, aber immerhin: fest-gebunden, ordentliches Papier. Und es war halt Eigentum.
Diese Anja hat sich gelöscht, ist geräuschlos aus dem Leben des Leihgebers verschwunden. Dabei war sie mit ihm während des Studiums gut befreundet. Sie hat keine Nummer hinterlassen, keine Adresse, nichts. Es wäre möglich gewesen, nachzuforschen, die Spur soll ins Saarland führen, aber damals war das Internet noch weitmaschig und lahm. Und es fehlte die Motivation. Hätte sie das Buch verloren und ins Wasser fallen lassen, wäre es einfach so geklaut worden – längst hätte ein Ersatz die Lücke im Regal gefüllt. Doch die gähnt, eine Art Narbe, die nicht schmerzt, aber bleibt, für immer sichtbar, ewig üble Laune macht – und das nur, weil diese Anja ein schlechtes Gewissen gehabt haben muss, vielleicht es noch mit sich trägt, die Ärmste.
Ein abwesendes Buch der Unmut. So was kommt vom Teilen: Der das Eigentumsrecht scheinbar lockernde Umgang mit Besitztümern ist dessen moralisch aufgeladene Bestätigung, weil das Vertrauen auf die Rückgabe des Überlassenen jeden bezahlbaren Wert übertrifft. Und wer sein Vertrauen missbraucht sieht, erwirbt das lächerliche Recht sich selbst ganz herzlich leidzutun.
Die Frage ist: Was wird aus diesen persönlichen Fährnissen des Teilens, wenn man es vom individuellen Austausch in ein ökonomisches System überführt, das Zeiten und Leistung mit einem Preisschild beklebt? Propheten der „Sharing Economy“ sind zuversichtlich, dass uns das vom Kapitalismus erlöst.
So frohlockt der britische Soziologe Matthew Daniels diesbezüglich: „Das Potenzial für einen ‚Triumph der Allmende‘“ – also einer auf Gemeinschaftseigentum basierenden Wirtschaftsordnung – „ist unübersehbar, und es wächst“. Dabei entgeht ihm, dass die Risiken des Teilens auch in der Hochphase der Allmende sprichwörtlich waren: „Beim Teilen bekommen manche alles und manche kein bisschen“, lautet eine Volksweisheit, die der englische Theologe John Ray 1672 dokumentiert hat.
Eine neue Taktik des Raffens
Folgerichtig nimmt soziale Ungleichheit dort, wo Sharing-Economy ihre größten Erfolge gefeiert hat, nicht ab, sondern zu: Die Uber-Chauffeure teilen ihr Auto und ihre Zeit mit dem Kunden, und sie teilen die Bezahlung für die Fahrt mit der vermittelnden Plattform. Die Anschaffungs-, Instandhaltungs-, Sprit-, Steuer- und Versicherungskosten verbleiben aber ganz bei ihnen.
Dank Airbnb können Leute in fremdenverkehrsstarken Regionen ihre Wohnungen den Touristen überlassen. Sie verdienen dadurch ein Zubrot – die Plattform ein Vermögen. Und bald schon werden die Zimmeranbieter abhängig von ihren kläglichen Zusatzeinnahmen sein, weil sie dazu beigetragen haben, dass die Mietkosten steigen.
Das Glücksversprechen, das im Begriff des Teilens mitschwingt, sein utopisches Moment dient dieser Sharing Economy dazu, eine neue Taktik des Raffens zu bemänteln, oder vornehm ausgedrückt: eine Neuauflage der primären Akkumulation. An der ging auch einst die historische Allmende zugrunde. Eben weil bei dieser Art zu teilen manche alles abbekommen. Und manche kein bisschen. Und das sind noch immer die meisten.