Die Zeit, in der Grundwasserreserven nach dem vorangegangenen Sommer sich normalerweise durch Niederschläge oder Schneeschmelze erholen, sei bereits zur Hälfte verstrichen. „Wir werden es nicht mehr auf normales Niveau schaffen“, sagte Wingering. Der Prozess der Erholung habe noch nicht einmal begonnen. Erst müsse der Boden auftauen, dann müssten Niederschläge oder langsam schmelzender Schnee den Boden durchnässen und sättigen, bevor überhaupt Wasser durchsickern und in die tiefen Schichten vordringen könne. „Das dauert.“
Zu wenig Grundwasser könne für Flüsse dramatisch sein, ergänzte Uwe Bergdolt, der sich bei der LUBW mit Fließgewässern beschäftigt. Sie wärmten sich schneller auf, das könne zu Sauerstoffabfall und schlimmstenfalls auch zum Sterben von Fischen und im Wasser lebenden Kleinstlebewesen führen.
Auch für Bäume, die sich über ihre tiefen Wurzeln mit Feuchtigkeit versorgen, bedeuteten niedrige Grundwasserpegel Stress, sagte Johannes Enssle vom Naturschutzbund Nabu.
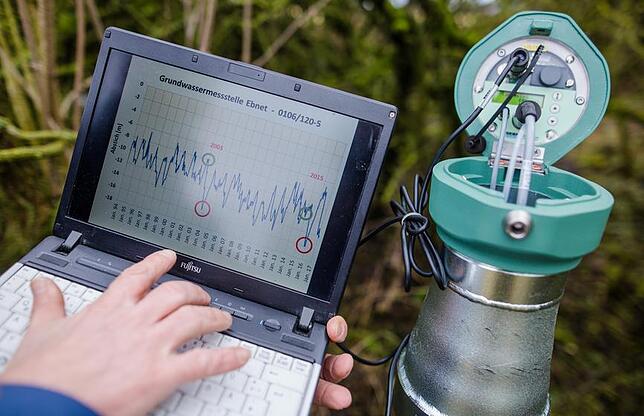
Die Trinkwasserversorgung im Südwesten ist hingegen nach Worten des Zweckverbandes Landeswasserversorgung (LW) nicht in Gefahr. Zwar sei der Stand des großen Wasserspeichers unter der Schwäbischen Alb einen Meter unter dem langjährigen Mittel. Der Zweckverband sorge bei solchen Wetterlagen aber vor: „Wir schauen dem Wettergeschehen nicht einfach zu, sondern schonen längst unsere Grundwasserreserven und greifen auf Flusswasser der Donau zurück“, sagte der LW-Sprecher.
Sollte es weiterhin wenig regnen, bekommen aber etwa Aussiedlerhöfe Schwierigkeiten, die nicht an das kommunale Wassernetz angeschlossen, sondern auf eigene Quellen angewiesen sind. „Die sitzen dann auf dem Trockenen und müssen Wasser von außen heranschaffen.“ Die Experten setzen nun auf viel Niederschlag im Frühjahr. „Was wir jetzt brauchen, sind viele Wochen Sauwetter“, sagt Wingering.




