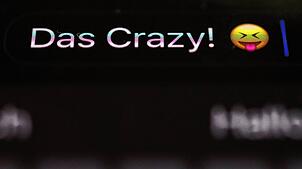Herr Renz-Polster, SUVs und Elterntaxis stauen sich morgens vor Kitas und Schulen. Nordrhein-Westfalen erlaubt es Kommunen nun, Straßen aus Sicherheitsgründen rund um Schulen für Autos sperren. Was halten Sie davon?
Eltern bringen ihre Kinder aus sehr unterschiedlichen Gründen mit dem Auto zur Schule. Pauschal kann ich das nicht mit „gut“ oder „schlecht“ bewerten. Früher waren die Schulwege anders, die Kinder konnten sie alleine gehen. Heute höre ich immer wieder, dass Kinder den Schulweg gehen könnten, die Eltern aber wegen des Verkehrs Bedenken haben.
Die Eltern sind auch viel mehr getaktet. Häufig arbeiten beide Elternteile und sind auf ein effektives Zeitmanagement angewiesen. Und bei manchen Kitas wird das Kind morgens nicht mehr angenommen, wenn es nicht pünktlich ist. Die Daumenschrauben der Eltern sind heute stark angezogen. Jetzt mit langem Finger pauschal sie zu zeigen ist nicht fair.
In diesem Zusammenhang ist schnell die Rede von Helikoptereltern. Sie meinen es eigentlich gut, aber an mancher Stelle vielleicht auch zu gut.
Ich mag den Begriff nicht, aber natürlich gibt es Eltern, bei denen die Balance durcheinander geraten ist zwischen dem, was sie für und mit ihrem Kind machen und dem, was sie auch ihr Kind alleine machen lassen.
Kinder brauchen viel Nähe und Begleitung, aber sie brauchen auch ihre eigene Spur, in der sie wachsen und sich bewähren können. Und zwar an den Aufgaben, die sie sich selber stellen. Das fehlt manchen Kindern heute. Aber oft eben nicht, weil die Eltern das nicht wollen oder nicht können, sondern vor allem, weil sich die Lebenswelt der Kinder verändert hat. Stichwort Institutionalisierung.
Damit meinen Sie, dass die Kinder morgens in Kitas und am Nachmittag in Turn- und Musikstunden unterwegs sind?
Ja, wir haben heute eine Bildungskindheit – Krippe, Kita, Schule, Hort, da sind viele Kinder die meiste Zeit des Tages immer nahe an Erwachsenen, immer mit einem Programm, immer mit dem Ziel sie zu bilden, sie zu fördern.
Kommt das Spielen da zu kurz?
Evolutionär betrachtet kommen die Kinder aus einer Welt, in der sie unglaublich viel gespielt haben, mit Älteren und Jüngeren. Aus sich selbst heraus, ohne vorgegebenes Programm.
Das heißt, die Eltern müssten ihnen in der freien Zeit auch mehr freie Zeit zum Spielen lassen?
Richtig. Spielen ist die Entwicklungsgrundlage des Kindes. Das haben wir vielfach vergessen und versuchen stattdessen, die Kinder mit allen möglichen Programmen zu fördern. Aber das kindliche Spielen ist Förderung.
Dabei bauen Kinder alle Grundkompetenzen auf, die sie brauchen: dass sie sich etwas zutrauen, mit anderen klarkommen, dass sie sozial verständig und kreativ werden und auch resilient, das heißt trotz aller Widrigkeiten in der Spur bleiben.

Was brauchen Kinder für eine gelungene Entwicklung?
Für die Entwicklung ihrer Persönlichkeit und die Ausbildung ihrer Kompetenzen brauchen Kinder zwei fast schon widersprüchliche Zutaten: einerseits viel Liebe und Beziehung, viel Vertrauen, viel Schutz. Gleichzeitig müssen sie aber auch aus sich heraus Selbstregulation erlernen, indem sie die Umwelt entdecken, Fehler machen, hinfallen und wieder aufstehen dürfen. Beides zusammen treibt die Entwicklung voran.
In indigenen Gemeinschaften sind vier- bis fünfjährige Kinder im Vergleich zu unseren Kindern emotional reifer und haben mehr soziale Kompetenz. Wie ist das zu erklären?
Sie haben beides zusammen: viel Rückhalt bei ihren Bindungspersonen, aber eben auch von klein auf viel Autonomie, das heißt, sie dürfen ihre Umwelt selbst viel mehr erforschen als bei uns, wo sich der Entdeckungsraum meist auf recht kleine künstliche Reservate beschränkt, wie das Kinderzimmer.
Was sicher auch eine Rolle spielt ist, dass bei uns die Zahl der Bezugspersonen sehr begrenzt ist, in indigenen Gemeinschaften wachsen die Kinder in einem Netz von Freunden und Verwandten unterschiedlicher Generationen auf, die Betreuende, Vorbilder und Lehrende sind.
Der Stamm macht die Kinder nach und nach mit den kulturellen Regeln vertraut, und richtet dabei auch durchaus Erwartungen an die Kinder: So machen wir das hier bei uns.
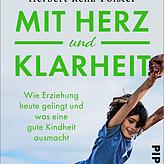
Wie gehen diese Gemeinschaften mit Zornanfällen der Kinder um?
Die Eltern mischen sich in den ersten drei Jahren wenig ein. Die Kinder dürfen unvernünftig sein, weil sie Kinder sind.
Sie sprechen in Ihrem Buch von vier Kleeblättern, die wichtig sind für die Entwicklung des Kindes: Sicherheit, Anerkennung und Zugehörigkeit und dazu das vierte Blatt, das Flügelblatt, das den Kindern die Freiheit zu wachsen gibt. Was meinen Sie mit dieser Freiheit?
Kleine Kinder helfen zum Beispiel gerne in der Küche mit. Wenn sie viel machen dürfen, blühen sie auf. Aber dazu muss man sie auch machen lassen. Und ihnen eine überschaubare Umgebung anbieten – mechanische Waage statt Digitalwaage etwa. Sie lernen dann auch schrittweise, wie man ein Messer benutzt, um Sachen zu schneiden.
Kinder wollen ab circa zwei Jahren ihren eigenen Kopf durchsetzen und kriegen Zornanfälle, weil sie Spaghetti plötzlich ohne Sauce essen wollen oder Brokkoli furchtbar finden. Sie sagen, dass Eltern in dieser Autonomiephase, wie Sie sie nennen, oft falsch abbiegen. Inwiefern?
Ein Teil der Eltern reagiert autoritär, das Kind wird gemaßregelt. Aus der Beziehung wird eine Art Kampfbeziehung. Die Eltern wollen das Kind einhegen und steuern. Sie verstehen nicht, dass es eine magische Linie gibt, über die die Kinder gehen müssen.
Ein kleines Kind überblickt die Folgen seiner Handlung in dem Alter nicht. Es reagiert zornig, ist frustriert, weil es an der Umwelt scheitert. Ein anderer Teil der Eltern will seinem Kind helfen, rasch ein reiferes Verhalten zu zeigen. Damit wenigstens ein paar Gramm Brokkoli hinter die Zähnchen kommen. Sie locken, loben, schieben an, fragen 100 Fragen: ‚Was willst du denn essen, wenn die Sauce nicht schmeckt?‘
Also man lässt die Kinder die Spaghetti so essen, wie sie wollen, und den Brokkoli meiden?
Natürlich. Man kann ihnen immer wieder ein neues Angebot machen. Manchmal essen sie ja auch ein anderes Gemüse. Doch so verlässlich die Kinder ihren Gemüseverzehr in diesem Alter einschränken, so verlässlich verschwindet das auch wieder und sie essen das, was ihre Eltern, die Oma und die Geschwister essen. Und das unabhängig davon, ob der Gemüseordnungsdienst in dieser heiklen Phase patrouilliert oder die Eltern die Nerven verlieren.
Sie sagen, dass Erwachsene ihren Kindern oft viel zu viel erklären, was gut und richtig ist. Was ist daran falsch?
Kinder beobachten ihre Umwelt ganz genau. Sie schauen, wie Beziehungen gestaltet werden. Das greifen sie daran ab, wie diese Beziehungen gelebt werden und wie die für sie bedeutsamen Menschen miteinander umgehen. Da muss man gar nicht erklären, was richtig und wichtig ist.
Das heißt, wenn die Eltern sagen, das Gemüse ist gesund, dann lernt das Kind das nicht über die Erklärung, sondern darüber, dass die Eltern es auch essen?
Kinder lernen es nicht nur, wenn die Eltern es essen, sondern sie beobachten, wie es den Eltern dabei geht. Das ist ähnlich wie bei der Werbung: Da würde niemand hinschauen, wenn jemand Unglückliches abgebildet wird. Die Kinder haben das gleiche Programm.
Gelungenes Leben interessiert sie, und das vor allem bei den Leuten, zu denen sie eine Beziehung haben. Wenn man Kindern stirnrunzelnd beim Essen Druck macht, lernen sie gar nichts.
Sie haben vier Kinder und vier Enkelkinder. Inwiefern hat sich Ihre Rolle als Großvater verändert, wenn Sie das mit Ihrer Elternrolle von früher vergleichen?
Als Großeltern hast du weniger Verantwortung und mehr Zeit. Du bist mehr auf der sonnigeren Spur unterwegs, weil du den Kindern tolle Angebote machst. Das ist etwas völlig anderes, wie wenn du dafür verantwortlich bist, dass der Laden läuft und immer einen Blick auf die Uhr haben musst.